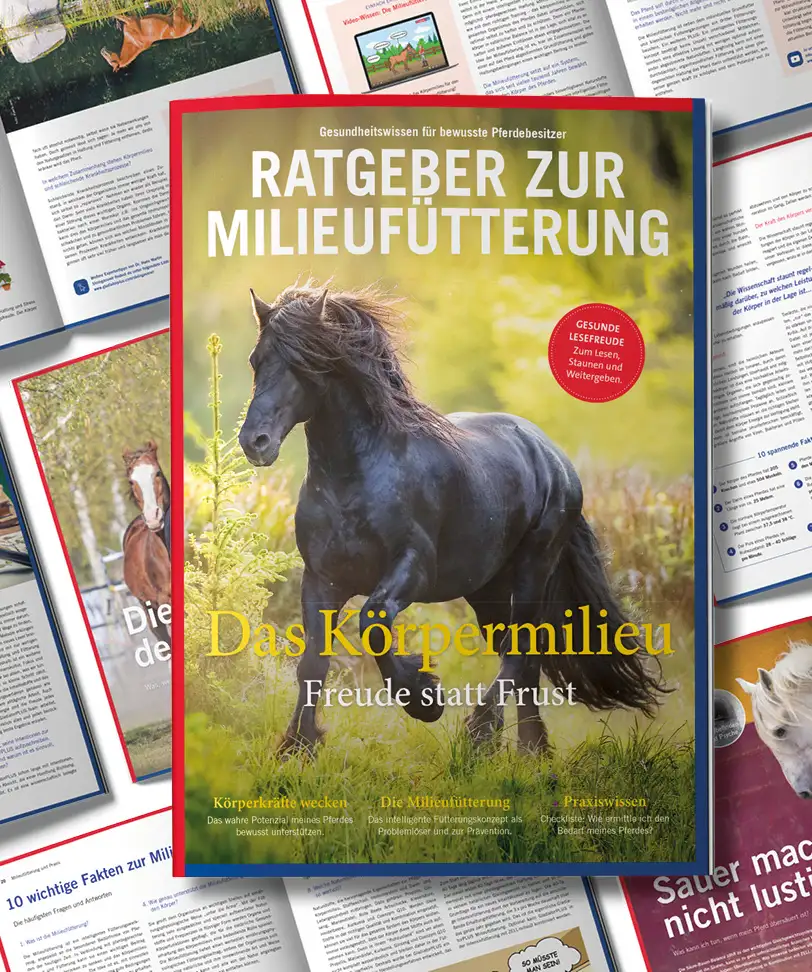Hufrehe beim Pferd
Wer seinem Pferd wirklich gerecht werden will, braucht vor allem eines: Wissen. Denn Gesundheit ist kein Zufall, sondern das Ergebnis kluger Entscheidungen. Dieser Ratgeber ist kein Schnellschuss, sondern das Ergebnis jahrelanger Erfahrung und intensiver Recherche. Er bietet dir fundiertes Hintergrundwissen – tiefergehend und ganzheitlich – weit über das hinaus, was sich online sonst so zusammenlesen lässt. Denn nur wer die Zusammenhänge kennt – wie Hufrehe entsteht, welche Rolle Fütterung, Stoffwechsel und das innere Körpermilieu spielen – kann die richtigen Impulse setzen. Für echte Gesundheit von innen heraus.
In diesem Hufrehe-Ratgeber erfährst du:
- Was Hufrehe eigentlich ist
- Welche Sofortmaßnahmen wichtig sind
- Wie du die Symptome einer Hufrehe erkennst
- Welche Rolle die Gesundheit von Darm, Leber und Körpermilieu spielt
- Welche Behandlungsmöglichkeiten es gibt
- Was du tun kannst, um deinem Pferd ganzheitlich zu helfen und es vor Hufrehe zu schützen
In diesem Hufrehe-Ratgeber erfährst du:
- Was Hufrehe eigentlich ist
- Welche Sofortmaßnahmen wichtig sind
- Wie du die Symptome einer Hufrehe erkennst
- Welche Rolle die Gesundheit von Darm, Leber und Körpermilieu spielt
- Welche Behandlungsmöglichkeiten es gibt
- Was du tun kannst, um deinem Pferd ganzheitlich zu helfen und es vor Hufrehe zu schützen
Du merkst schon: Die Hufrehe-Behandlung ist komplex und braucht ein Team aus Experten: Tierarzt, Hufschmied, Tierheilpraktiker, Milieu-Therapeut, Futterberater und informierter Besitzer. Je besser alle Hand in Hand arbeiten, umso besser sind die Erfolgsaussichten.
Du merkst schon: Die Hufrehe-Behandlung ist komplex und braucht ein Team aus Experten: Tierarzt, Hufschmied, Tierheilpraktiker, Milieu-Therapeut, Futterberater und informierter Besitzer. Je besser alle Hand in Hand arbeiten, umso besser sind die Erfolgsaussichten.
„Es ist, als würde mein Pferd auf glühenden Kohlen stehen.“ So beschreiben viele Pferdehalter den Anblick ihres Tieres, das unter einer akuten Hufrehe leidet. Was viele nicht wissen: Hufrehe ist nicht „nur“ eine extrem schmerzhafte Huferkrankung. Tatsächlich entpuppt sie sich als komplexe systemische Erkrankung, die den gesamten Organismus deines Pferdes betrifft. Die Hufrehe ist meist lediglich die sprichwörtliche Spitze des Eisbergs.
Wenn du Hufrehe und ihre Ursachen wirklich verstehen willst, musst du also tiefer schauen als bis zur schmerzhaften Entzündung der Huflederhaut. Die Krankheit hat ihren Ursprung tief im Inneren des Pferdekörpers. Betrachte die Hufrehe also gewissermaßen als Warnsystem, das dir signalisiert: Im Stoffwechsel oder bei der Hufbearbeitung ist etwas massiv im Argen.
Sicher ist: Eine akute Hufrehe ist immer ein Notfall. Unbehandelt kann sie im schlimmsten Fall lebensbedrohlich sein – und Pferdemenschen viele schlaflose Nächte im Stall bereiten. Sicher ist aber auch: Je schneller du reagierst, desto besser die Heilung. Je besser du verstehst, was im Körper deines Pferdes passiert, desto gezielter kannst du helfen und dafür sorgen, dass die inneren Kräfte deines Pferdes so stark sind, dass es von Hufrehe verschont bleibt.
Du vermutest Hufrehe bei deinem Pferd? Dann solltest du jetzt schnell und vor allem besonnen handeln – die ersten Stunden sind entscheidend! Allerdings zeigen nicht alle Pferde mit Hufrehe die gleichen Symptome. Manche Tiere entwickeln einzelne, vielleicht nur subtile Anzeichen, während sich bei anderen viele klassische Symptome bemerkbar machen.
Klar ist aber: Die akute Hufrehe ist immer ein Notfall. Kontaktiere daher sofort einen Tierarzt, idealerweise gemeinsam mit einem Hufschmied, wenn du Verdacht schöpfst. Lieber einmal zu viel als zu wenig anrufen!
Achte auf diese Anzeichen:
- Dein Pferd zeigt plötzlich eine deutliche Bewegungsunlust – vor allem auf hartem Boden.
- Es läuft nur noch zaghaft um die Kurve.
- Es tritt langsam und bedacht zuerst mit dem Ballen auf.
- Es tritt ständig von einem Bein aufs andere.
- Es legt sich ungewöhnlich oft hin.
- Es nimmt die typische „Sägebock-Stellung“ ein.
- Es gibt nur noch ungern die Hufe.
- Es hat ein „Schmerzgesicht“: Ohren schräg nach hinten gestellt, angespannter Maulbereich, schmale Nüstern.
- Die Hufe fühlen sich ungewöhnlich warm an.
- Du kannst einen pochenden Puls an den Fesseln fühlen.

Achte auf diese Anzeichen:
- Dein Pferd zeigt plötzlich eine deutliche Bewegungsunlust – vor allem auf hartem Boden.
- Es läuft nur noch zaghaft um die Kurve.
- Es tritt langsam und bedacht zuerst mit dem Ballen auf.
- Es tritt ständig von einem Bein aufs andere.
- Es legt sich ungewöhnlich oft hin.
- Es nimmt die typische „Sägebock-Stellung“ ein.
- Es gibt nur noch ungern die Hufe.
- Es hat ein „Schmerzgesicht“: Ohren schräg nach hinten gestellt, angespannter Maulbereich, schmale Nüstern.
- Die Hufe fühlen sich ungewöhnlich warm an.
- Du kannst einen pochenden Puls an den Fesseln fühlen.

Diese Erste-Hilfe-Maßnahmen kannst du treffen
- Kühle die heißen Hufe vor allem in den ersten 72 Stunden mit sehr kaltem Wasser.
- Nimm das Eisen ab
- Bringe dein Pferd in eine dick eingestreute Box oder sorge im Offenstall mit Waldboden und einer Schlammgrube für weichen Boden, um die Hufe zu entlasten. Die Pferde suchen instinktiv das kühle, weiche Loch.
- Vermeide Stress jeder Art sowie Bewegung – jetzt ist absolute Ruhe angesagt!
- Futterumstellung: Reiche gut abgelagertes, hochwertiges Heu. Stelle dann so bald wie möglich auf zuckerarmes Heu mit maximal acht Prozent Zucker um, denn die größte Gefahr lauert im Grundfutter.
Folgende Rechnung verdeutlicht, warum du besonders bei der Fütterung genau hinschauen musst: Bei einem Zuckergehalt von 15 Prozent enthält ein Kilo Heu etwa 150 Gramm Zucker. Ein 500-Kilo-Pferd frisst zehn Kilo Heu am Tag, also die unglaubliche Menge von 1,5 Kilo Zucker. Die zehn Kilo Heu müssen bleiben, jedoch mit zuckerärmeren Heu und einer Unterstützung des Zuckerstoffwechsels mit einer Entsäuerung. Auf Kraftfutter bitte verzichten!
Als systemische Krankheit kann Hufrehe unterschiedlichste Ursachen haben. Umso wichtiger für den Heilungsverlauf ist also auch die richtige Diagnose und Behandlung. Im nächsten Kapitel erfährst du mehr über die Hufrehe und das, was dabei im Körper deines Pferdes passiert.
Diese Erste-Hilfe-Maßnahmen kannst du treffen
- Kühle die heißen Hufe vor allem in den ersten 72 Stunden mit sehr kaltem Wasser.
- Nimm das Eisen ab
- Bringe dein Pferd in eine dick eingestreute Box oder sorge im Offenstall mit Waldboden und einer Schlammgrube für weichen Boden, um die Hufe zu entlasten. Die Pferde suchen instinktiv das kühle, weiche Loch.
- Vermeide Stress jeder Art sowie Bewegung – jetzt ist absolute Ruhe angesagt!
- Futterumstellung: Reiche gut abgelagertes, hochwertiges Heu. Stelle dann so bald wie möglich auf zuckerarmes Heu mit maximal acht Prozent Zucker um, denn die größte Gefahr lauert im Grundfutter.
Folgende Rechnung verdeutlicht, warum du besonders bei der Fütterung genau hinschauen musst: Bei einem Zuckergehalt von 15 Prozent enthält ein Kilo Heu etwa 150 Gramm Zucker. Ein 500-Kilo-Pferd frisst zehn Kilo Heu am Tag, also die unglaubliche Menge von 1,5 Kilo Zucker. Die zehn Kilo Heu müssen bleiben, jedoch mit zuckerärmeren Heu und einer Unterstützung des Zuckerstoffwechsels mit einer Entsäuerung. Auf Kraftfutter bitte verzichten!
Als systemische Krankheit kann Hufrehe unterschiedlichste Ursachen haben. Umso wichtiger für den Heilungsverlauf ist also auch die richtige Diagnose und Behandlung. Im nächsten Kapitel erfährst du mehr über die Hufrehe und das, was dabei im Körper deines Pferdes passiert.
Die Hufrehe, medizinisch Laminitis genannt, ist eine hochgradig schmerzhafte, aber nicht infektiöse Entzündung der Huflederhaut – sie findet also ohne Beteiligung von Bakterien statt. Was viele nicht wissen: Hufrehe ist keine reine Huferkrankung, sondern vielmehr die Folge einer länger andauernden Schieflage des Stoffwechsels.
Zum Vergleich: Menschen, die an Diabetes leiden, können im Krankheitsverlauf beispielsweise Augenschäden erleiden – doch das macht Diabetes nicht zu einer Augenkrankheit. Deshalb musst du den Blick auf den gesamten Organismus deines Pferdes richten.
Grundsätzlich kann Hufrehe an jedem der vier Beine auftreten – in einigen Fällen sogar an allen vier Hufen gleichzeitig. Allerdings trifft es die Vorderhufe häufiger, da sie gut 60 Prozent des Körpergewichtes tragen. Damit du dir besser vorstellen kannst, was bei einer Hufrehe passiert, werfen wir einen Blick ins Innere – genauer gesagt hinter die Hufkapsel, also dem äußeren, sichtbaren Teil des Hufes.
Drinnen befindet sich die in gesundem Zustand stark durchblutete Lederhaut. Sie umgibt das Hufbein und stellt so eine Verbindung zwischen dem Hufbein und der Hufkapsel bzw. Hornkapsel her. Innen kleidet sie die Hornkapsel aus und ist zuständig für die Produktion von Hufhorn.Sie bildet tausende feine Lamellen, die sich mit den innenliegenden Hornlamellen der Hufkapsel verzahnen – fast wie bei einem dreidimensionalen Klettverschluss.
"Hufrehe ist mehr als ein Schmerz im Huf
– sie ist das sichtbare Warnsignal eines entgleisten Stoffwechsels. Wenn das fein aufeinander abgestimmte Zusammenspiel im Inneren des Hufes aus dem Gleichgewicht gerät, verliert das Pferd buchstäblich den Halt unter seinen Füßen.“
"Hufrehe ist mehr als ein Schmerz im Huf
– sie ist das sichtbare Warnsignal eines entgleisten Stoffwechsels. Wenn das fein aufeinander abgestimmte Zusammenspiel im Inneren des Hufes aus dem Gleichgewicht gerät, verliert das Pferd buchstäblich den Halt unter seinen Füßen.“
Die Lamellenstruktur sorgt für eine enge und belastbare Verbindung zwischen der Hufkapsel und dem Hufbein. Dann kommen noch Sehnen und Bänder ins Spiel: Die tiefe Beugesehne, die an der Rückseite des Hufbeins ansetzt, übt einen konstanten Zug nach hinten und unten aus. Die gemeinsame Strecksehne, die vorne am Hufbein ansetzt, wirkt als funktionelle Gegenspielerin zur tiefen Beugesehne. Der Fesselträger, ein starkes Band, stützt das Hufbein noch zusätzlich gegen den Zug der tiefen Beugesehne ab.
Du siehst: Ist alles in Ordnung, haben wir hier ein fein abgestimmtes Zusammenspiel aus Lamellen, Sehnen und Bändern, das in gesundem Zustand das Hufbein stabil, flexibel und bodenparallel in seiner Position hält. Gleichzeitig wird das Gewicht deines Pferdes gleichmäßig auf die Hufkapsel verteilt. Eben eine meisterliche Konstruktion der Natur.
Kommt es aber zu Durchblutungsstörungen der Huflederhaut, schwellen die empfindlichen Lamellen an und entzünden sich. Die Verbindung zwischen Hufbein und Hufkapsel wird geschwächt, der Zug der Beugesehne wirkt stärker, der „Klettverschluss“ droht sich zu lösen.
Und wo kein richtiger Halt mehr vorhanden ist, wirkt das Körpergewicht umso mehr auf die Gesamtstruktur, und das Hufbein drückt immer tiefer in die Hufkapsel. Es gibt zwei Hauptformen einer solchen Hufbeinverlagerung, die bei einer Hufrehe auftreten können: Rotation und Absenkung.
Bei einer Hufbeinrotation kippt das Hufbein nach vorne und unten und steht nun stärker auf der Spitze, weil der Zug der tiefen Beugesehne nicht mehr ausreichend ausgeglichen wird. Das ist nicht nur sehr schmerzhaft für dein Pferd, es besteht auch die Gefahr, dass sich Knochensubstanz an der Spitze des Hufbeins abbaut, wenn die Rotation nicht frühzeitig durch Veränderung der Hufstellung gestoppt wird.
Die Hufbeinabsenkung, auch Hufbeinsenkung genannt, ist schwerwiegender: Die Verbindung zwischen den Lamellen und dem Hufbein löst sich so stark, dass das Hufbein durch das Eigengewichts deines Pferdes in Richtung der Hufsohle absinkt. Anders als bei der Rotation bleibt die Neigung des Hufbeins zwar erhalten, dafür verschiebt sich aber das gesamte Hufbein nach unten.
In schweren Fällen kann es sogar dazu kommen, dass das Hufbein die Sohle des Hufs durchbricht – ein Zustand, der als „Ausschuhen“ bezeichnet wird und nicht weniger als lebensbedrohlich für dein Tier ist. Nichtsdestotrotz kannst du solche schweren Verläufe meist vermeiden, wenn du die Symptome einer Hufrehe frühzeitig erkennst und entsprechend schnell Maßnahmen dagegen triffst. Besser noch: Du triffst die richtigen Maßnahmen, damit dein Pferd erst gar keine Hufrehe bekommt.
[Zum Inhaltsverzeichnis]
Im Video: Was im Huf passiert
Du kannst deinem Pferd eine Menge Leid ersparen, wenn du schon früh erkennst, dass eine Hufrehe im Anmarsch sein könnte. Aber genau das ist auch die große Herausforderung: Die Anzeichen sind manchmal so subtil, dass man sie leicht übersehen kann – selbst als erfahrene Pferdehalter.
Wie du aber auch weißt, ist jedes Pferd ein Individuum – einige zeigen deutlich an, dass etwas nicht stimmt. Dagegen sind andere, allen voran Ponys, wahre Meister im Kaschieren ihrer Schmerzen. Umso wichtiger, dass du als Pferdemensch die Fühler ausstreckst und deinem „Irgendwas-ist-anders“-Gefühl nachgehst.
Sicher ist: Es gibt nicht das eine untrügliche Anzeichen, an dem du sofort und zu 100 Prozent eine manchmal innerhalb sehr kurzer Zeit entstehende Hufrehe erkennen könntest. Zumal sie auch nicht plötzlich über Nacht entsteht, sondern sich latent entwickelt – also ohne erkennbare Anzeichen.
Erst im weiteren Verlauf zeigen sich die Hufrehe-Symptome mal mehr, mal weniger ausgeprägt. Deshalb schauen wir uns nun einmal die verschiedenen Hufrehe-Stadien sowie ihre möglichen Anzeichen an, auf die du achten kannst.
Wer neigt zur Hufrehe?
Manche Pferde und Ponys bleiben ihr Leben lang von Hufrehe verschont, während andere immer wieder gefährdet sind. Es gibt mehrere Faktoren, die das Risiko erhöhen.
- Rasse und Veranlagung: Besonders leichtfuttrige Rassen wie Haflinger oder Isländer haben eine genetische Neigung zur Hufrehe.
- Übergewicht: Ein zu hohes Körpergewicht kann die Entstehung der Krankheit begünstigen.
- Hufbearbeitung: Fehler bei der Hufbearbeitung, wie zu lange Zehen, zu enge Hufeisen oder ein eingeschränkter Hufmechanismus können das Risiko erhöhen.
- Stoffwechselerkrankungen: Krankheiten wie das Equine Metabolische Syndrom (EMS) oder das Cushing-Syndrom (ECS) beeinträchtigen den Zuckerstoffwechsel und erhöhen die Anfälligkeit.
Vorerkrankungen: Pferde, die bereits Hufrehe hatten, reagieren besonders empfindlich.
3.1
Erste Anzeichen einer Hufrehe
Das Vorläuferstadium
Auf den ersten Blick scheint noch nichts allzu dramatisch. Dein Pferd läuft vielleicht nicht mehr ganz so schwungvoll, es hebt die Hufe öfter an oder es verlagert das Gewicht von einem Bein aufs andere. Dabei versucht es schlicht, den Druck von den schmerzenden Stellen zu nehmen, ohne großes Aufheben darum zu machen.
Beim Hufegeben zeigt sich dagegen oft der erste Widerstand: Hebt dein Pferd sonst brav den Huf, zögert es jetzt plötzlich. Dann könnte es sich beispielsweise beim Aufheben des Beins an dich lehnen oder es macht sich beim Schmied extra schwer. Nicht etwa aus Trotz – sondern, weil es unangenehm ist, das Gewicht auf den schmerzenden Huf zu verlagern.
In Schritt und Trab wirkt der Gang „klemmig“ oder steif. Besonders auf hartem Boden oder in engen Wendungen scheint es, als würde dein Pferd wie auf Eiern laufen, und es setzt die Hufe auffällig vorsichtig.
Wenn du jetzt die Hufe anfühlst, können sie bereits wärmer sein als sonst. An den Fesselarterien seitlich an der Fessel spürst du möglicherweise einen deutlichen, wahrnehmbaren Puls – ein Hinweis darauf, dass die Huflederhaut Alarm schlägt.
[Zum Inhaltsverzeichnis]
Wer neigt zur Hufrehe?
Manche Pferde und Ponys bleiben ihr Leben lang von Hufrehe verschont, während andere immer wieder gefährdet sind. Es gibt mehrere Faktoren, die das Risiko erhöhen.
- Rasse und Veranlagung: Besonders leichtfuttrige Rassen wie Haflinger oder Isländer haben eine genetische Neigung zur Hufrehe.
- Übergewicht: Ein zu hohes Körpergewicht kann die Entstehung der Krankheit begünstigen.
- Hufbearbeitung: Fehler bei der Hufbearbeitung, wie zu lange Zehen, zu enge Hufeisen oder ein eingeschränkter Hufmechanismus können das Risiko erhöhen.
- Stoffwechselerkrankungen: Krankheiten wie das Equine Metabolische Syndrom (EMS) oder das Cushing-Syndrom (ECS) beeinträchtigen den Zuckerstoffwechsel und erhöhen die Anfälligkeit.
Vorerkrankungen: Pferde, die bereits Hufrehe hatten, reagieren besonders empfindlich.
3.1
Erste Anzeichen einer Hufrehe
Das Vorläuferstadium
Auf den ersten Blick scheint noch nichts allzu dramatisch. Dein Pferd läuft vielleicht nicht mehr ganz so schwungvoll, es hebt die Hufe öfter an oder es verlagert das Gewicht von einem Bein aufs andere. Dabei versucht es schlicht, den Druck von den schmerzenden Stellen zu nehmen, ohne großes Aufheben darum zu machen.
Beim Hufegeben zeigt sich dagegen oft der erste Widerstand: Hebt dein Pferd sonst brav den Huf, zögert es jetzt plötzlich. Dann könnte es sich beispielsweise beim Aufheben des Beins an dich lehnen oder es macht sich beim Schmied extra schwer. Nicht etwa aus Trotz – sondern, weil es unangenehm ist, das Gewicht auf den schmerzenden Huf zu verlagern.
In Schritt und Trab wirkt der Gang „klemmig“ oder steif. Besonders auf hartem Boden oder in engen Wendungen scheint es, als würde dein Pferd wie auf Eiern laufen, und es setzt die Hufe auffällig vorsichtig.
Wenn du jetzt die Hufe anfühlst, können sie bereits wärmer sein als sonst. An den Fesselarterien seitlich an der Fessel spürst du möglicherweise einen deutlichen, wahrnehmbaren Puls – ein Hinweis darauf, dass die Huflederhaut Alarm schlägt.
[Zum Inhaltsverzeichnis]
3.2
Die subklinische Hufrehe
Die Gefahr im Verborgenen
Diese Form der Hufrehe ist sicher am schwierigsten zu erkennen. Dein Pferd zeigt kaum Anzeichen – keine deutliche Lahmheit, keine offensichtlichen Schmerzen. Und doch geht in den Hufen einiges vor sich: Die empfindliche Huflederhaut nimmt bereits Schaden, wichtige Stoffwechselprozesse im Huf geraten aus der Balance.
Wenn du genau hinschaust, kannst du vielleicht feine Veränderungen bemerken: zarte Ringe an der Hufwand, einen minimal veränderten Hufwinkel oder kleine Unterschiede im Bewegungsablauf. Dein Pferd geht etwas steifer und mit weniger Schwung als sonst. Diese Anzeichen sind so dezent, dass du sie im Alltag leicht übersehen kannst
Besonders aufmerksam solltest du bei Pferden mit Stoffwechselerkrankungen wie EMS und Cushing oder Hufrehevorerkrankungen sein, oder aber auch generell bei leichtfuttrigen Pferden. Gerade bei diesen kann sich eine Hufrehe besonders heimtückisch entwickeln. Denn das generelle Problem ist: Die subklinische Hufrehe bleibt oft unbemerkt, bis plötzlich doch ein akuter Reheschub zuschlägt.
Umso wichtiger ist es daher für dich, dein Pferd und dessen Gesundheitszustand im Blick zu behalten, gegebenenfalls auch regelmäßige Check-ups durch den Tierarzt, Tielheilpraktiker oder Hufschmied durchführen zu lassen. Vor allem dann, wenn es schon mal mit Hufrehe zu kämpfen hatte.
[Zum Inhaltsverzeichnis]
3.3
Akute Phase der Hufrehe
Der Schmerz übernimmt das Kommando
Jetzt werden die Anzeichen der Hufrehe ernster und deutlicher – es zählt jeder Moment, weshalb du spätestens jetzt sofort handeln solltest. Die ersten 72 Stunden sind die wichtigsten! Im Vergleich zum Vorläuferstadium ist es nun fast so, als hätte jemand einen Schalter umgelegt: Die Lahmheit kommt plötzlich, dein Pferd will sich kaum noch bewegen, vielleicht bleibt es sogar regungslos stehen oder legt sich ungewöhnlich häufig hin.
Es könnte außerdem schwitzen, obwohl es sich nicht angestrengt hat. Dein Pferd wirkt in dieser Phase womöglich auch apathisch oder verweigert das Futter. Sicher ist: Schmerz macht müde – und das sieht man dem Tier an
Besonders auffällig dabei ist die sogenannte „Sägebock-Stellung“: Dabei streckt dein Pferd die Vorderbeine nach vorne und verlagert das Gewicht auf die Hinterhand, um die schmerzenden Vorderhufe zu entlasten.
Und die Hufe? Wenn du sie jetzt anfasst, sind sie deutlich warm. Und selbst bei sanften Berührungen an den Hufen könnte dein Pferd auf Schmerz reagieren. An den Fesselarterien pocht der Puls so stark, dass du ihn kaum übersehen kannst. Sicher ist aber: Ohne schnelle Behandlung kann es in dieser Phase bereits zur gefürchteten Hufbeinrotation kommen.

Auch hier ein Pferd, dass seine Vorderhufe zu entlasten versucht
3.4
Subakute Phase der Hufrehe
Trügerische Besserung
Nun wird es trügerisch: Der akute Reheschub scheint vorbei, die Situation entspannt sich scheinbar. Die starken Schmerzsymptome lassen nach, dein Pferd wirkt wieder fitter, bewegt sich besser. Doch diese Verbesserung kann täuschen. Willkommen in der subakuten Phase – einer kritischen Zeit, in der sich entscheidet, ob dein Pferd auf dem Weg zur Heilung ist oder sich eine chronische Hufrehe entwickelt.
Denn auch wenn die äußeren Anzeichen nachlassen, kann im Inneren des Hufs der Entzündungsprozess noch immer auf Hochtouren weiterlaufen. Die Durchblutungsstörungen bestehen fort, und die Verbindung zwischen Hufbein und Hufkapsel ist noch längst nicht stabil. In dieser Phase droht die gefürchtete Hufbeinrotation oder -absenkung – selbst wenn dein Pferd sich äußerlich bereits besser fühlt.
Besonders in diesem Stadium solltest du die Behandlung konsequent fortsetzen. Lass dich also nicht von der vermeintlichen Besserung täuschen. Denn je nachdem, wie du dein Tier durch die subakute Phase bringst, stellst du die Weichen für den Krankheits- beziehungsweise Heilungsverlauf.
[Zum Inhaltsverzeichnis]
3.5
Chronische Hufrehe-Phase
Langwierige Folgen
Wenn du Hufrehe nicht schnell genug behandelst oder sie immer wiederkehrt, so hinterlässt dies Spuren. Gut 24 bis 72 Stunden, nachdem der Entzündungsprozess der Huflederhaut begonnen hat, zeigen sich deutlichere Symptome. Hat sich im Huf etwas strukturell verändert – beispielsweise in Form einer Verlagerung des Hufbeins – oder lahmt das Pferd bereits 48 Stunden spricht man von einer chronischen Hufrehe.
Das Pferd mag die akute Entzündung zwar überstanden haben, doch die Schäden an den Hufstrukturen sind nun da. Außerdem kann dein Pferd anfällig für neue Reheschübebleiben. Die Veränderungen spielen sich bei einer chronischen Hufrehe aber nicht mehr nur im Inneren des Hufes ab. Du kannst sie mittlerweile auch äußerlich erkennen: Die weiße Linie an der Hufsohle wird breiter. Das ist ein Hinweis darauf, dass die innere Verbindung nicht mehr stabil ist.
Die Zehenwand biegt sich nach innen, die Form des Hufs wirkt verändert. „Reheringe“, feine Wachstumsrillen an der Hufwand, erzählen von vergangenen Entzündungen. Auch kann der Huf deformiert erscheinen – zum Beispiel unregelmäßig verdickt, gewölbt, oder die Zehe kann nach oben gebogen sein, was man als „Pantoffelhufe“ bezeichnet. Gott sei Dank sieht man dies nur noch selten.
Auch an deinem Pferd gehen die langwierigen Folgen nicht spurlos vorüber. Manche Tiere bleiben lahm, andere wirken müde, appetitlos, wollen sich nicht mehr bewegen oder legen sich öfter hin. Sie scheinen sich mit dem Schmerz arrangiert zu haben.
Die Ursachen einer Hufrehe beim Pferd sind zwar sehr vielfältig, aber eines haben sie gemeinsam: Am Ende steht immer eine Durchblutungsstörung in der Huflederhaut, die eine Entzündung der empfindlichen Lamellen entfacht und die Verbindung zwischen ihnen und der Hufkapsel schädigt.
Im Pferdekörper greifen viele verschiedene Stoffwechselprozesse ineinander – angefangen vom Hormonhaushalt über die Verdauung bis hin zur Durchblutung. Gerät nur eines dieser Elemente aus der Balance, kann dies eine Kettenreaktion auslösen, die sich bis in die Hufe fortsetzt.
Eine besondere Rolle spielt dabei das Körpermilieu, zu dem unter anderem auch der Säure-Basen-Haushalt und die Leberfunktion gehören. Wird beispielsweise der Verdauungstrakt übersäuert, kann dies die Darmflora aus dem Gleichgewicht bringen.
Dabei sterben nützliche Bakterien ab und setzen Endotoxine frei, die über die Blutbahn bis in die empfindliche Huflederhaut gelangen und dort Entzündungsprozesse begünstigen. Gleichzeitig kann eine chronische Übersäuerung des Stoffwechsels die Zellregeneration beeinträchtigen und die Aufnahme essenzieller Nährstoffe erschweren, was die Huflederhaut zusätzlich schwächt.
"Hufrehe entsteht nicht einfach im Huf
– sie ist oft das sichtbare Ende einer langen Kette innerer Ungleichgewichte. Wenn Verdauung, Leber oder Stoffwechsel aus dem Takt geraten, leidet am Ende auch der Huf. Bei Hufrehe lahmt im Grunde der ganze Organismus."
"Hufrehe entsteht nicht einfach im Huf
– sie ist oft das sichtbare Ende einer langen Kette innerer Ungleichgewichte. Wenn Verdauung, Leber oder Stoffwechsel aus dem Takt geraten, leidet am Ende auch der Huf. Bei Hufrehe lahmt im Grunde der ganze Organismus."
Auch die Leber spielt eine Schlüsselrolle in der Regulation des Körpermilieus, da ihr Job darin besteht, Giftstoffe abzubauen und auszuscheiden. Steht sie durch eine hohe Stoffwechselbelastung unter Dauerbeschuss – etwa durch eine unausgewogene Fütterung oder Übergewicht, kann sie Schadstoffe nicht mehr effizient abbauen.
Und so verbleiben mehr belastende Substanzen im Organismus, die sich auch auf die Durchblutung und den Zustand der Huflederhaut auswirken können. Eine überforderte Leber kann somit indirekt zur Entstehung oder Verschlimmerung einer Hufrehe beitragen.
Bei übergewichtigen Pferden kommt erschwerend hinzu, dass das Fettgewebe Botenstoffe produziert, die Entzündungen im Körper fördern. So entsteht ein Teufelskreis: Die Stoffwechselstörung belastet das Körpermilieu, und das geschwächte Milieu macht den Körper noch anfälliger für weitere Störungen.
Doch was löst eine Hufrehe konkret aus? Was wir dir schon vorweg sagen können: Ernährung und Haltung spielen eine ganz wesentliche Rolle. Deswegen widmen wir uns im folgenden Teil verstärkt diesen beiden Faktoren – ohne jedoch die übrigen Auslöser außer Acht zu lassen.
[Zum Inhaltsverzeichnis]
4.1
Fütterungs- und stoffwechselbedingte Rehe
Ernährung als Gefahrenquelle
Die mit Abstand häufigste Form der Hufrehe ist die Fütterungsrehe. Sie entsteht, wenn der Stoffwechsel deines Pferdes durch falsche Ernährung aus dem Gleichgewicht gerät. Als reiner Pflanzenfresser ist das Verdauungssystem des Tieres auf faserreiche Nahrung ausgelegt – also auf Heu, Gras und strukturreiche Futtermittel. Doch mit Getreidestärke oder Fruktanen aus Gras kann es nur bedingt umgehen.
Besonders im Frühjahr und Herbst steigt der Fruktangehalt im Gras an – vor allem, wenn nachts Frost herrscht und tagsüber die Sonne scheint. Dann speichern Gräser besonders viele Fruktane. Auch ständig kurz abgefressenes Gras kann problematisch sein: Unter Stress produziert das Gras vermehrt diese Reservestoffe, um zu überleben.
Ebenfalls oft unterschätzt: trockene oder überweidete Flächen. Diese Gräser enthalten oft noch höhere Fruktankonzentrationen als hochgewachsene Wiesen. Doch nicht nur Fruktane können zur Falle werden – auch eine Fütterungspanne kann eine Hufrehe auslösen. Es wäre zumindest nicht das erste Mal, dass sich ein Pferd heimlich Zutritt zur Futterkammer verschafft und seinem Appetit auf riesige Mengen stärkehaltigen Kraftfutters freien Lauf lässt.

Ständig kurz abgefressenes Gras kann problematisch sein – auch wegen seines hohen Fruktangehalts
Vielleicht ahnst du schon, was das Problem ist: Der Verdauungstrakt ist einfach nicht darauf ausgelegt, derart große Mengen an Stärke und Fruktanen auf einen Schlag zu verarbeiten. Die Verdauung dieser Stoffe beginnt nämlich eigentlich schon im Dünndarm mit speziellen Enzymen, den Amylasen, welche Stärke in Zucker aufspalten.
Doch die Menge dieser Enzyme ist begrenzt – und das ist genetisch festgelegt. Manche Pferderassen, wie Warmblüter, haben eine höhere Amylase-Aktivität, während Robustrassen oder Ponys oft empfindlicher auf stärke- und fruktanreiches Futter reagieren.
Ist der Dünndarm dann mit zu großen Mengen überfordert, gelangen unverdaute Stärke und Fruktane in den Dickdarm – und das löst eine fatale Kettenreaktion aus. Die Bakterienflora gerät aus dem Gleichgewicht, weil Stärke und Fruktane dort in kurzer Zeit vergoren werden. Dabei entstehen Milchsäure und kurzkettige Fettsäuren, was den normalerweise fast neutralen pH-Wert im Dickdarm stark absinken lässt – der Darm übersäuert.
Wenn das Darmmilieu kippt – und mit ihm das gesamte Körpermilieu deines Pferdes
Ist dieser Gärungsprozess einmal in Gang geraten, nimmt die Kettenreaktion ihren Lauf:
- Bestimmte Bakterien (z. B. Milchsäureproduzenten) vermehren sich explosionsartig.
- Nützliche Bakterien (z. B. Cellulose-abbauende Mikroben) sterben in großer Menge ab.
- Beim Absterben dieser Bakterien werden Endotoxine und andere Giftstoffe freigesetzt.
- Die Giftstoffe schädigen die Darmwand, sie wird durchlässiger („Leaky-Gut-Syndrom“), wodurch Giftstoffe in den Blutkreislauf gelangen.
- Die Leber wird überfordert, weil sie die freigesetzten Toxine nicht schnell genug abbauen kann.
Ernährung als Gefahrenquelle
Die mit Abstand häufigste Form der Hufrehe ist die Fütterungsrehe. Sie entsteht, wenn der Stoffwechsel deines Pferdes durch falsche Ernährung aus dem Gleichgewicht gerät. Als reiner Pflanzenfresser ist das Verdauungssystem des Tieres auf faserreiche Nahrung ausgelegt – also auf Heu, Gras und strukturreiche Futtermittel. Doch mit Getreidestärke oder Fruktanen aus Gras kann es nur bedingt umgehen.
Besonders im Frühjahr und Herbst steigt der Fruktangehalt im Gras an – vor allem, wenn nachts Frost herrscht und tagsüber die Sonne scheint. Dann speichern Gräser besonders viele Fruktane. Auch ständig kurz abgefressenes Gras kann problematisch sein: Unter Stress produziert das Gras vermehrt diese Reservestoffe, um zu überleben.
Ebenfalls oft unterschätzt: trockene oder überweidete Flächen. Diese Gräser enthalten oft noch höhere Fruktankonzentrationen als hochgewachsene Wiesen. Doch nicht nur Fruktane können zur Falle werden – auch eine Fütterungspanne kann eine Hufrehe auslösen. Es wäre zumindest nicht das erste Mal, dass sich ein Pferd heimlich Zutritt zur Futterkammer verschafft und seinem Appetit auf riesige Mengen stärkehaltigen Kraftfutters freien Lauf lässt.

Ständig kurz abgefressenes Gras kann problematisch sein – auch wegen seines hohen Fruktangehalts
Vielleicht ahnst du schon, was das Problem ist: Der Verdauungstrakt ist einfach nicht darauf ausgelegt, derart große Mengen an Stärke und Fruktanen auf einen Schlag zu verarbeiten. Die Verdauung dieser Stoffe beginnt nämlich eigentlich schon im Dünndarm mit speziellen Enzymen, den Amylasen, welche Stärke in Zucker aufspalten.
Doch die Menge dieser Enzyme ist begrenzt – und das ist genetisch festgelegt. Manche Pferderassen, wie Warmblüter, haben eine höhere Amylase-Aktivität, während Robustrassen oder Ponys oft empfindlicher auf stärke- und fruktanreiches Futter reagieren.
Ist der Dünndarm dann mit zu großen Mengen überfordert, gelangen unverdaute Stärke und Fruktane in den Dickdarm – und das löst eine fatale Kettenreaktion aus. Die Bakterienflora gerät aus dem Gleichgewicht, weil Stärke und Fruktane dort in kurzer Zeit vergoren werden. Dabei entstehen Milchsäure und kurzkettige Fettsäuren, was den normalerweise fast neutralen pH-Wert im Dickdarm stark absinken lässt – der Darm übersäuert.
Wenn das Darmmilieu kippt – und mit ihm das gesamte Körpermilieu deines Pferdes
Ist dieser Gärungsprozess einmal in Gang geraten, nimmt die Kettenreaktion ihren Lauf:
- Bestimmte Bakterien (z. B. Milchsäureproduzenten) vermehren sich explosionsartig.
- Nützliche Bakterien (z. B. Cellulose-abbauende Mikroben) sterben in großer Menge ab.
- Beim Absterben dieser Bakterien werden Endotoxine und andere Giftstoffe freigesetzt.
- Die Giftstoffe schädigen die Darmwand, sie wird durchlässiger („Leaky-Gut-Syndrom“), wodurch Giftstoffe in den Blutkreislauf gelangen.
- Die Leber wird überfordert, weil sie die freigesetzten Toxine nicht schnell genug abbauen kann.
Warum es auf das Immunsystem im Darm ankommt
- Was viele nicht wissen: Der größte Teil des Immunsystems befindet sich im Darm des Pferdes. Und dabei hat sich die Natur etwas gedacht, denn der Darm bildet die größte Kontaktfläche zu den Einflüssen der Außenwelt. Alles, was aufgenommen wird, wird hier vom Körper geprüft und reguliert.
Ist die Darmflora intakt und im Gleichgewicht, ist auch die Immunabwehr dazu in der Lage, mit den Herausforderungen umzugehen, denen dein Pferd ständig ausgesetzt ist. Kippt das Darmmilieu jedoch, wird nicht nur die Verdauung gestört – auch das Immunsystem gerät ins Wanken:
Der Darm verliert seine Schutzbarriere: Giftstoffe und Krankheitserreger dringen leichter in den Körper ein. - Die Immunzellen im Darm sind überlastet: Das gesamte Immunsystem steht unter Dauerstress.
Und so haben dann auch chronische Entzündungen leichtes Spiel, sich im gesamten Körper deines Pferdes auszubreiten – und die Huflederhaut besonders anfällig für entzündliche Prozesse zu machen.
Du siehst: Ein gesundes Körpermilieu ist enorm wichtig für die Selbstregulation des Organismus. Nur wenn das innere Ökosystem im Gleichgewicht bleibt, können alle Immun- und Stoffwechselprozesse reibungslos ablaufen. Gerät das Körpermilieu aus dem Gleichgewicht, kann dein Pferd chronischem Stoffwechselstress ausgesetzt sein, der natürlich auch die Huflederhaut einbezieht.
Übersäuerung – Der Säure-Basen-Haushalt außer Balance
Durch die Übersäuerung im Dickdarm gerät auch der Säure-Basen-Haushalt des Pferdes aus dem Gleichgewicht. Normalerweise besitzt der Körper deines Tieres verschiedene Mechanismen, um überschüssige Säuren abzufangen – über das Blut, die Nieren und die Atmung. Doch wenn die anfallende Säurelast zu hoch wird, kann der Organismus nicht mehr ausreichend gegensteuern.
Was passiert dann?
- Der Körper muss überschüssige Säuren im Gewebe ablagern.
- Die Zellregeneration wird beeinträchtigt.
- Das Immunsystem kann weniger effektiv auf Entzündungen reagieren.
- Die Huflederhaut wird anfälliger für schädliche Reize.
- Die Aufnahme und Verwertung wichtiger Mineralstoffe wie Calcium, Magnesium und Zink wird gestört, da ihre Löslichkeit und Bioverfügbarkeit vom pH-Wert abhängig sind. Dies kann sich negativ auf Knochenstabilität, Muskelfunktion und das Nervensystem auswirken.
- Ein gestörter Ionenaustausch kann den Elektrolythaushalt belasten und Muskelkrämpfe, Erschöpfung oder eine schwächere Regeneration nach Belastung verursachen.
Eine anhaltende Übersäuerung beeinträchtigt nicht nur Muskulatur und Zellregeneration, sondern kann auch die Reaktionsfähigkeit des Immunsystems schwächen und entzündliche Prozesse verstärken – insbesondere in der Huflederhaut.
Jetzt weißt du: Die Fütterung betrifft nicht bloß den Verdauungstrakt, sondern den gesamten Stoffwechsel deines Pferdes. Schaffe also ein stabiles Körpermilieu, eine intakte Darmflora und einen ausgeglichenen Säure-Basen-Haushalt, um dein Tier vor Hufrehe zu schützen.
Übersäuerung – Der Säure-Basen-Haushalt außer Balance
Durch die Übersäuerung im Dickdarm gerät auch der Säure-Basen-Haushalt des Pferdes aus dem Gleichgewicht. Normalerweise besitzt der Körper deines Tieres verschiedene Mechanismen, um überschüssige Säuren abzufangen – über das Blut, die Nieren und die Atmung. Doch wenn die anfallende Säurelast zu hoch wird, kann der Organismus nicht mehr ausreichend gegensteuern.
Was passiert dann?
- Der Körper muss überschüssige Säuren im Gewebe ablagern.
- Die Zellregeneration wird beeinträchtigt.
- Das Immunsystem kann weniger effektiv auf Entzündungen reagieren.
- Die Huflederhaut wird anfälliger für schädliche Reize.
- Die Aufnahme und Verwertung wichtiger Mineralstoffe wie Calcium, Magnesium und Zink wird gestört, da ihre Löslichkeit und Bioverfügbarkeit vom pH-Wert abhängig sind. Dies kann sich negativ auf Knochenstabilität, Muskelfunktion und das Nervensystem auswirken.
- Ein gestörter Ionenaustausch kann den Elektrolythaushalt belasten und Muskelkrämpfe, Erschöpfung oder eine schwächere Regeneration nach Belastung verursachen.
Eine anhaltende Übersäuerung beeinträchtigt nicht nur Muskulatur und Zellregeneration, sondern kann auch die Reaktionsfähigkeit des Immunsystems schwächen und entzündliche Prozesse verstärken – insbesondere in der Huflederhaut.
Jetzt weißt du: Die Fütterung betrifft nicht bloß den Verdauungstrakt, sondern den gesamten Stoffwechsel deines Pferdes. Schaffe also ein stabiles Körpermilieu, eine intakte Darmflora und einen ausgeglichenen Säure-Basen-Haushalt, um dein Tier vor Hufrehe zu schützen.
4.2
Belastungsrehe
Wenn es einfach zu viel wird
Auch die Belastungsrehe ist eine der häufiger auftretenden Hufrehe-Arten. Vor allem erkennst du an ihr erneut, wie eng verschiedene Körpersysteme miteinander zusammenhängen. Wie du am Namen schon erahnen kannst, entsteht eine Belastungsrehe dann, wenn ein oder mehrere Hufe mechanisch überlastet werden – sei es durch einseitige Dauerbelastung, harte Untergründe oder plötzliche Überanstrengung, vor allem auch mit neuem Beschlag.
Tipp: Mit neuem Beschlag oder frisch bearbeiteten Hufen muss dein Pferd sofort freudig loslaufen. Zeigt es sich hier schon verhalten, läuft etwas falsch.
Die Ursachen weiterhin: Stoffwechselprozesse geraten ins Stocken, die Durchblutung der Huflederhaut wird gestört – es kommt zu Gewebeschäden, die letztlich eine Hufrehe auslösen können. Es ist allerdings nicht allein die mechanische Belastung, die hier ihren Einfluss auf dein Pferd ausübt.
Körpermilieu und Stressniveau beeinflussen, wie gut der Organismus mit Belastungen umgehen kann. Steht das Milieu im Körper deines Pferdes dagegen durch Stoffwechselprobleme oder chronischen Stress unter Druck, kann sich eine Belastungsrehe schneller entwickeln – und schwerer ausheilen.
Apropos Stress: Wird das Stresshormons Cortisol verstärkt ausgeschüttet, verengen sich die Blutgefäße – und das schränkt die Durchblutung der Huflederhaut weiter ein. Außerdem destabilisiert chronischer Stress den Blutzuckerhaushalt, schwächt das Immunsystem und verstärkt Muskelverspannungen. Und letzteres erhöht die mechanische Belastung auf einzelne Hufe durch das veränderte Gangbild noch weiter.
Belastung gehört zum Pferdeleben
– galoppieren, tragen, ausgleichen. Ein gesunder Huf ist dafür gemacht. Doch wenn die Belastung einseitig, zu plötzlich oder zu intensiv ist, kann es schmerzhaft werden. Besonders dann, wenn dein Pferd im Inneren nicht stark ist. Dann fehlt auch dem Huf die Kraft, zu kompensieren."
Belastung gehört zum Pferdeleben
– galoppieren, tragen, ausgleichen. Ein gesunder Huf ist dafür gemacht. Doch wenn die Belastung einseitig, zu plötzlich oder zu intensiv ist, kann es schmerzhaft werden. Besonders dann, wenn dein Pferd im Inneren nicht stark ist. Dann fehlt auch dem Huf die Kraft, zu kompensieren."
Wie entsteht eine Belastungsrehe?
Entlastet dein Pferd ein Bein nach einer Verletzung, starken Lahmheiten oder anderweitigen Erkrankung, trägt das gegenüberliegende Bein eine viel größere Last. Und das kann Folgen haben:
- Dauerhafter Druck auf die Huflederhaut: Die empfindlichen Blutgefäße in der Lederhaut werden durch das hohe Gewicht eingeengt. Die Huflederhaut wird schlechter mit Sauerstoff- und Nährstoffen versorgt.
- Gestörter Abtransport von Stoffwechselprodukten: Abbauprodukte verbleiben im Gewebe, das Zellmilieu verschlechtert sich und gerät außer Balance.
- Mechanischer Stress auf die Lamellenstruktur: Die Verbindung zwischen Hufbein und Hufkapsel kann geschädigt werden – ein kritischer Faktor für die Entwicklung einer Hufrehe.
Lange Strecken auf hartem Boden
Auch wenn beide Beine gleichermaßen belastet werden, kann eine Belastungsrehe entstehen. Und zwar, wenn die Hufe deines Pferdes anhaltenden Erschütterungen auf harten, unnachgiebigen Böden ausgesetzt sind. Man spricht dann von einer Marschrehe. Typische Situationen sind:
- Ausgedehnte Wanderritte oder Training auf Asphalt oder Schotter, wenn der fehlende Hufmechanismus die Durchblutung stört.
- Plötzliche harte Belastung nach längerer Pause, wenn das Gewebe nicht ausreichend trainiert ist.
Warum zu harte Böden oder ein falscher Beschlag auf Dauer so problematisch für dein Pferd sind: Auf weichem Boden wird der Huf bei jedem Schritt leicht auseinandergespreizt. Dabei wird die Durchblutung gefördert. Auf hartem Untergrund fehlt dieser Mechanismus. Die feinen Kapillaren in der Huflederhaut werden weniger durchblutet und die Mikrozirkulation gerät ins Stocken.
Plötzlich hohe Belastung ohne Kondition
Untrainierte Pferde, die plötzlich schwerer Arbeit ausgesetzt werden, haben oft Probleme mit der Durchblutungsanpassung in den Hufen. Ihre Gefäße und Gewebestrukturen sind noch nicht auf die hohe Belastung vorbereitet, was der Huflederhaut zusetzt.

Ein zu viel an Belastung kann genauso Rehe verursachen wie ein zu wenig
Besonders gefährdet sind:
- Pferde, die nach längerer Pause sofort intensives Training absolvieren.
- Junge oder untrainierte Pferde, die plötzlich auf hartem Boden arbeiten müssen.
- Pferde mit schwacher Hufstruktur, z. B. sehr dünner Sohle oder schlechter Hornqualität.
Belastungsrehe durch langes Stehen
Auch lange Stallphasen ohne ausreichende Bewegung können eine Hufrehe begünstigen. Dann ist von einer Stallrehe die Rede. Wieder wird die Blutzirkulation gestört, und zwar einerseits durch das Eigengewicht, andererseits durch fehlenden Hufmechanismus. Dadurch wird die Huflederhaut weniger gut mit Sauerstoff- und Nährstoffen versorgt. Dasselbe passiert auch auf sehr langen Transporten im Hänger, die oft vielfältigen Stress verursachen.

Steht ein Pferd zu lange, etwa in der Box, kann das Blut in den Hufen schlechter zirkulieren
Ebenso kann eine schlechte oder falsche Hufbearbeitung durch den Schmied dazu führen, dass das Pferd seine Hufe unphysiologisch belastet. Auch das geht zulasten der Durchblutung im Huf, was das Risiko einer Hufrehe erhöhen kann.
4.3
Geburtsrehe
Risiko: Nachgeburt
Die Geburtsrehe ist eine besonders tückische Form der Erkrankung, die frischgebackene Pferdemamas betrifft. Die Ursache klingt zunächst harmlos: kleinste Reste der Nachgeburt, die in der Gebärmutter verbleiben. Doch was dann folgt, ist eine regelrechte Kettenreaktion im Körper der Stute.
Diese Nachgeburtsreste werden von Bakterien besiedelt und zersetzen sich. Dabei entstehen Endotoxine, die über die Blutbahn wie kleine Giftpfeile durch den gesamten Körper wandern. Und auch die empfindliche Huflederhaut kann durch diese toxische Invasion in Mitleidenschaft gezogen werden, wenn die feinen Blutgefäße angegriffen werden und die Zirkulation nicht mehr stimmt.
Doch nicht nur verbliebene Nachgeburtsreste sind gefährlich für dein Pferd. Auch eine Gebärmutterschleimhautentzündung (Endometritis) kann den gleichen fatalen Prozess in Gang setzen.
4.4
Vergiftungsrehe
Der Kampf mir den Toxinen
Eine Vergiftungsrehe zeigt ganz deutlich, wie empfindlich der Körper deines Pferdes auf Giftstoffe reagiert. Auslöser gibt es viele:
Giftige Pflanzen als heimliche Gefahr
Die pflanzlichen Übeltäter können überall auf der Weide lauern: Das gefürchtete Jakobs-Kreuzkraut, die unscheinbar wirkende Robinie, Rizinus oder auch Eicheln, Walnussblätter und Walnüsse. Sie alle enthalten Giftstoffe, die Leber und Nieren auf eine harte Probe stellen, aber auch die Huflederhaut in Mitleidenschaft ziehen können. Ahornsetzlinge, vor allem im Frühling unter Ahornbäumen auf den Weiden zu finden, können für Pferde sogar tödlich sein.
Doch auch vom Menschen eingebrachte Gifte wie Herbizide, Fungizide oder Pestizide kann dein Pferd über belastete Weiden oder kontaminiertes Heu aufnehmen. Ein besonders heimtückischer Feind ist der Schimmelpilz, weil er oft erst dann sichtbar ist, wenn die Belastung durch seine Giftstoffe (Mykotoxine) bereits hoch ist. Staubiges Heu ist fast immer mit Schimmelsporen durchzogen und sollte nur gewässert verfüttert werden. Tipp: regelmäßige Geruchsprobe! Schimmel ist leicht zu erriechen.
4.5
Die Wurmkur: ein unerwarteter Hufrehe-Auslöser?
Ein unerwarteter Hufrehe-Auslöser?
Was viele überrascht: Auch eine massive Entwurmung kann bei stark verwurmten Pferden eine Hufrehe auslösen. Allerdings liegt der Grund nicht im Wurmmittel selbst, sondern in den absterbenden Parasiten. Sterben plötzlich große Mengen Würmer ab, werden ihre Zerfallsprodukte ebenfalls in großen Mengen freigesetzt – mitunter mehr, als der Stoffwechsel auf einen Schlag verträgt.

Manchmal kann auch eine Wurmkur Hufrehe auslösen – vor allem dann, wenn viele Parasiten auf einmal absterben und den Stoffwechsel zusätzlich belastet
4.6
Medikamentenrehe
Heilung als Gefahr?
Bei der Medikamentenrehe rückt vor allem Cortison als Übeltäter ins Licht. Denn es steht im Verdacht, Hufrehe zu begünstigen, indem es in den Zuckerstoffwechsel eingreifen und die Insulinempfindlichkeit der Körperzellen verringern kann. Das Ergebnis ist aufs Neue ein Teufelskreis: Der Blutzucker steigt, der Körper produziert mehr Insulin, die Zellen werden noch resistenter dagegen – ein Mechanismus, der dem Equinen Metabolischen Syndrom (EMS) ähnelt.
Aber auch andere Medikamente können problematisch sein. Beispielsweise entzündungshemmende Medikamente wie Phenylbutazon, das oft selbst zur Schmerzlinderung bei Hufrehe eingesetzt wird. Dieses kann die Mikrozirkulation in den Hufen beeinträchtigen, was die Heilung an sich verlangsamen kann – insbesondere dann, wenn die Huflederhaut bereits vorgeschädigt ist.
Ebenfalls nicht ohne: Langzeitantibiotika. Zum einen zerstören sie krankmachende Bakterien, zum anderen aber auch nützliche Bakterien, was die Darmflora belastet. Du erinnerst dich: Der Darm ist quasi das Hauptquartier des Immunsystem deines Pferdes. Gerät dieses außer Balance, haben es Endotoxine über eine geschädigte Darmwand einfacher, in die Blutbahn zu gelangen und den Stoffwechsel zu belasten.
[Zum Inhaltsverzeichnis]
4.7
Stoffwechselbedingte Hufrehe
Wenn das innere Gleichgewicht gestört ist
Zwei Stoffwechselerkrankungen stehen immer wieder im Zusammenhang bei der Entstehung von Hufrehe: das Equine Cushing Syndrom (ECS) und das Equine Metabolische Syndrom (EMS). Beide Erkrankungen stören das feine hormonelle Gleichgewicht im Körper deines Pferdes.
Cushing Syndrom als plötzlicher Hufrehe-Auslöser
Bei Cushing ist die Ursache ein gutartiger Tumor in der Hirnanhangsdrüse (Hypophyse), der die Hormonproduktion durcheinanderbringt. Dieser Tumor produziert zu viel ACTH, ein Hormon, das wiederum die Nebennieren zur verstärkten Produktion des Stresshormons Cortisol anregt – und das wirbelt dann den gesamten Stoffwechsel durcheinander:
- Der Blutzuckerspiegel steigt, weil Cortisol die Wirkung von Insulin hemmt.
- Das Immunsystem wird geschwächt, wodurch das Pferd anfälliger für Infektionen ist.
- Die Muskulatur baut sich ab, während gleichzeitig Fettpolster entstehen.
- Das Fellwachstum verändert sich, oft zeigt sich ein langes, lockiges Fell, das nicht richtig abgeworfen wird.
Eine plötzlich auftretende Hufrehe ist nicht selten das erste Alarmzeichen für Cushing – noch weit bevor die typischen äußeren Veränderungen sichtbar werden, etwa das lange, lockige Fell oder die ungewöhnlichen Fettpolster.
„Hufrehe ist oft nicht das erste oder das einzige Problem eines Pferdes
,aber das erste sichtbare. Wer früh hinschaut und versteht, kann viel verhindern.“
„Hufrehe ist oft nicht das erste oder das einzige Problem eines Pferdes
,aber das erste sichtbare. Wer früh hinschaut und versteht, kann viel verhindern.“
Equines Metabolisches Syndrom (EMS)
Das EMS ist gewissermaßen „Diabetes Typ 2“ beim Pferd – und eine der häufigsten Ursachen für wiederkehrende Reheschübe. Das macht besonders den guten Futterverwertern unter den Pferden zu schaffen. Also jenen leichtfuttrigen Rassen wie Haflinger, Ponys oder Isländer, die in der freien Natur einen Vorteil gehabt hätten, doch unter menschlicher Obhut scheinbar von Luft und Liebe dick werden.
Die Veranlagung zu EMS war ursprünglich ein Überlebensvorteil. Wie du weißt, sind Pferde eigentlich Steppentiere, die aber heute in einer von uns Menschen gemachten Umgebung leben müssen. In kargen Steppengebieten ist es ideal, wenn ein Pferd aus wenig Futter viel Energie gewinnen kann. Doch mit ständig verfügbarem energie- und zuckerreichem Futter wird diese Sparsamkeit zum Problem. Die Pferde nehmen schnell zu, und das überschüssige Körperfett beginnt, den Zuckerstoffwechsel zu stören.
Bei EMS ist das die sogenannte Insulinresistenz: Die Körperzellen reagieren nicht mehr richtig auf das Hormon Insulin, das normalerweise den Blutzucker reguliert. Das Insulin kannst du dir wie einen Schlüssel vorstellen, der den Zucker in die Zellen einschleusen soll. Bei einer Insulinresistenz passt dieser Schlüssel nicht mehr richtig ins Schloss. Der Körper produziert daraufhin immer mehr Insulin – als würde er immer mehr neue Schlüssel nachmachen, in der Hoffnung, dass einer endlich passt.
So führt EMS zu Hufrehe:
- Dauerhaft hohe Insulinwerte schädigen die feinen Blutgefäße in der Huflederhaut.
- Insulin verengt die Blutgefäße, was die Durchblutung weiter verschlechtert.
- Fettgewebe setzt entzündungsfördernde Botenstoffe frei, die systemische Entzündungen im Körper verstärken.
- Übergewicht belastet die Hufe zusätzlich, wodurch es zu einer mechanischen Überlastung kommt.
EMS-Pferde neigen zu wiederkehrenden Reheschüben, besonders wenn sie weiterhin zucker- oder stärkereiches Futter erhalten. Je früher du EMS also erkennst und dem Körper deines Pferdes hilfst, damit umzugehen, desto größer die Chancen, dass du dein Pferd vor Hufrehe bewahrst.
Im Video: Mehr zu den Ursachen
Auch, wenn wir uns an dieser Stelle wiederholen: Eine Hufrehe ist hochgradig schmerzhaft. Und genau darum sind bei der Behandlung zuallererst Dinge gefragt, die einen schnellen Effekt haben und dein Pferd in kürzester Zeit aus dem Kreislauf aus Schmerz und Stress holen.
Denn Schmerz bedeutet Stress und Stress verursacht mitunter noch mehr Schmerz. Und obendrein geht all das nicht spurlos an anderen Bereichen im Körper vorbei, was den Krankheitsverlauf weiter verschlimmern kann. Ganz zu schweigen davon, was in der der Psyche des Pferdes vor sich geht: Als Fluchttier hat es schlichtweg Überlebensangst, wenn es wegen stark schmerzenden Hufen das Gefühl hat, seinem Instinkt nicht mehr folgen – sprich: fliehen zu können.
Doch auch deine berechtigten Sorgen – also, dein Stress – können auf dein Pferd übergehen. Diese empfindsamen Tiere merken sofort, wenn etwas mit dir nicht stimmt. Einer der größten Fehler, den du jetzt also begehen kannst: in Panik ausbrechen.
Weder dir noch deinem Pferd ist damit geholfen, wenn du das Pferd jetzt vorsichtshalber nur noch in der Box stehen lässt, obwohl es das gar nicht gewöhnt ist. Oder, wenn du die Futter-Notbremse ziehst und plötzlich viel weniger Heu und mehr Stroh fütterst. Ein solch drastischer Futterstopp kann nämlich ebenso Stoffwechselstörungen auslösen.

Alles im Eimer? Ist bei Hufrehe gut. Denn: Kühlung ist eine der Erste-Hilfe-Maßnahmen
Der erste Schritt in Richtung Schmerzlinderung sind die Erste-Hilfe-Maßnahmen, die du am Anfang dieses Artikels kennengelernt hast. Schauen wir uns also einmal die Hufrehe-Behandlungsmethoden an, für die du einen Tierarzt beziehungsweise Tierheilpraktiker oder auch deinen Hufschmied heranziehst.
[Zum Inhaltsverzeichnis]
Wie du inzwischen weißt: Hufrehe entsteht unter anderem durch Durchblutungsstörungen der Huflederhaut. Um also ihre Durchblutung zu verbessern, können blutverdünnende Medikamente wie Heparin und gefäßerweiternde Mittel wie Acepromazin eingesetzt werden.
Diese Mittel helfen dabei, den Blutfluss in den kleinen Gefäßen der Huflederhaut zu verbessern, sodass Sauerstoff und Nährstoffe besser an die geschädigten Stellen gelangen können. Das kann gerade in der akuten Phase der Hufrehe, wenn die Durchblutung stark gestört ist, den Heilungsprozess deines Pferdes positiv beeinflussen.
Der große Vorteil dieser Therapie ist, dass sie den betroffenen Geweben mit der verbesserten Blutzirkulation hilft, sich besser zu regenerieren. Und sie kann dazu beitragen, dass sich die Schäden an der Huflederhaut nicht weiter ausbreiten.
Doch auch bei diesen Medikamenten gibt es Risiken: Da sie die Blutgerinnung beeinflussen, kann es bei Verletzungen oder bei Pferden mit Blutgerinnungsstörungen oder erhöhter Blutungsneigung eben zu verstärkten Blutungen kommen. Auch können Gefäßverletzungen durch die Mittel nur verzögert heilen.
"Blutverdünnende Medikamente wie Heparin können in der akuten Phase der Hufrehe Leben retten
– doch sie sind kein Allheilmittel. Ihre Wirkung ist groß, ihre Risiken sind es auch. Deshalb gilt: Was dem einen Pferd hilft, kann dem anderen schaden. Die richtige Dosis zur richtigen Zeit entscheidet."
"Blutverdünnende Medikamente wie Heparin können in der akuten Phase der Hufrehe Leben retten
– doch sie sind kein Allheilmittel. Ihre Wirkung ist groß, ihre Risiken sind es auch. Deshalb gilt: Was dem einen Pferd hilft, kann dem anderen schaden. Die richtige Dosis zur richtigen Zeit entscheidet."
Und gerade bei Heparin muss sehr genau dosiert werden – denn eine zu hohe Dosis kann die Blutgerinnung viel zu stark hemmen. Der Tierarzt muss diese Behandlung also genau überwachen und die Dosierung ganz individuell auf dein Pferd abstimmen. In einigen Fällen werden regelmäßig Bluttests durchgeführt, um sicherzustellen, dass die Blutgerinnung auch im richtigen Bereich bleibt.
Außerdem ist eine Blutverdünnungstherapie nicht in jeder Hufrehe-Phase sinnvoll. In der akuten Phase der Hufrehe, wenn die Durchblutung stark gestört ist und das Risiko von Mikrothromben besteht, kann sie helfen. Doch in der subakuten und chronischen Phase ist sie meist nicht angeraten, da der akute Entzündungsprozess bereits abgeklungen ist und oft keine signifikanten Durchblutungsstörungen mehr vorliegen. In diesen Stadien überwiegen die Risiken.
[Zum Inhaltsverzeichnis]
5.3
Die Hufe mechanisch entlasten
Bei Hufrehe ist der Huf enormen inneren Kräften ausgesetzt, und die Verbindung zwischen Huflederhaut und Hornkapsel ist durch die Entzündung geschwächt. Das ist sehr schmerzhaft für dein Pferd, und im schlimmsten Fall kann das Hufbein in der Hufkapsel rotieren oder absinken.
Was wir mit der mechanischen Entlastung des Hufes also erreichen wollen: Dein Pferd soll wieder leichter stehen können, der Huf soll stabilisiert sein, der Schmerz soll nachlassen, und die bessere Durchblutung soll dafür sorgen, dass die geschädigten Strukturen sich besser regenerieren können. Dein Pferd solltest du, bevor es überhaupt mit irgendeiner Maßnahme losgeht, erst einmal auf weichen Boden stellen – idealerweise auf dicker Einstreu, Sand oder Torf. Das nimmt zusätzlichen Druck von den Hufen.
Was du aber wissen solltest: Wird der Huf falsch entlastet, kann das neue Probleme mit sich bringen. Denn eine Fehlstellung beziehungsweise Fehlbelastung des Hufes kann den Zustand und Heilungsverlauf verschlechtern. Darum sind immer ein erfahrener Tierarzt, Tierheilpraktiker oder Hufschmied deine Ansprechpartner, wenn es um folgende Methoden geht:
Gipsverbände – Softcast- und Hardcast
Der Softcast-Verband bietet einerseits Stabilität, andererseits passt er sich der natürlichen Bewegung des Fesselgelenks an. Er gibt an der Fessel nach und entlastet so den Huf, ohne ihn komplett starr zu fixieren. Diese funktionelle Immobilisation ist wichtig, um die Durchblutung nicht zusätzlich zu behindern und die Muskulatur vor Schwund zu bewahren. Um einen Softcast-Verband anzubringen, braucht es Fachkenntnisse, um die perfekte Balance zwischen Stabilität und Beweglichkeit zu erreichen.
Ein Hardcast-Verband ist dagegen sehr starr und besteht aus einem vollständig aushärtenden Material. Manche Tierärzte oder Tierheilpraktiker setzen Hardcast-Verbände ein, wenn maximale Stabilisierung und Fixierung angeraten ist – etwa, wenn die Hufbeinrotation schon stärker fortgeschritten ist. Der Huf wird dann in seiner Position fixiert, unerwünschte Bewegungen werden stark minimiert.
Und das ist genau dann ein Nachteil, wenn die starre Fixierung die Blutzirkulation beeinträchtigt und so der Heilungsprozess gebremst wird. Oft wird der Druck auf die Zehe durch einen Hardcast-Verband noch höher. Ist der Gips nicht ausreichend gepolstert oder wurde er unsachgemäß angelegt, können außerdem Druckstellen entstehen. Über längere Zeit kann eine vollständige Fixierung zu Muskelschwund oder steifen Gelenken führen.
Umgekehrt angebrachte Hufeisen
Bei dieser Methode zur Entlastung des Hufs bei Hufrehe wird das Hufeisen so befestigt, dass der offene Teil nach vorne zeigt, während der geschlossene Steg den hinteren Bereich des Hufs stützt. Mit dieser Technik zielt man darauf ab, den schmerzhaften Zehenbereich zu entlasten und den Abrollpunkt des Hufs zu optimieren.

Eine Form der Hufentlastung: umgekehrt angebrachte Hufeisen
Das umgekehrt angebrachte Hufeisen schafft mehr Zehenfreiheit, da der empfindliche vordere Bereich des Hufs weniger belastet wird. Gleichzeitig verlagert es den Abrollpunkt nach hinten, was den Einfluss der tiefen Beugesehne auf das Hufbein reduziert. Es senkt den Zug auf das entzündete Gewebe der Huflederhaut und kann so Schmerzen lindern und auch das Risiko einer Hufbeinrotation verringern.
Ein Hufeisen umgekehrt exakt zu positionieren, dass es deinem Pferd wirklich Entlastung bringt, erfordert viel Erfahrung und Fachkenntnis des Hufschmieds. Abgesehen davon ist der Spielraum bei der Anpassung natürlich eingeschränkter, wenn sich die Hufsituation verändert hat. Vor allem bei extremer Instabilität oder fortgeschrittener Hufbeinrotation stößt diese Methode an ihre Grenzen.
Hufschuhe mit Polsterung – Schutz und Komfort für dein Pferd
Gut gepolsterte Hufschuhe können deinem Pferd viel Erleichterung bringen und Schmerzen reduzieren – vor allem in der akuten Phase. Sie schützen seine Hufe vor harten Untergründen, verteilen den Druck gleichmäßiger und dämpfen Stöße. Dadurch fällt es deinem Tier oft leichter, sich wieder zu bewegen.
Ein großer Vorteil von Hufschuhen ist, dass sie den natürlichen Hufmechanismus unterstützen. Bei vielen Modellen kannst du spezielle Pads und Polstereinlagen einlegen, mit denen du die Hufsohle zusätzlich entlastest. Allerdings sind Hufschuhe nicht für jedes Pferd geeignet. Damit sie wirklich helfen, müssen sie perfekt sitzen – sonst können Druck- oder Scheuerstellen entstehen. Manch ein Pferd braucht außerdem auch etwas Eingewöhnungszeit, bevor es sich mit den Schuhen wohl fühlt.
Und da wäre da noch das Thema Hygiene: Da Hufschuhe Feuchtigkeit und Schmutz einschließen können, solltest du sie regelmäßig ausziehen und die Hufe kontrollieren. Besonders in feuchter Witterung kann sich unter den Schuhen eine ideale Umgebung für Strahlfäule oder Pilzinfektionen entwickeln.
[Zum Inhaltsverzeichnis]
5.4
Erhöhung der Trachten
Die Trachten mit speziellen Keilen anzuheben soll den Zug der tiefen Beugesehne verringern. Das wieder soll weniger Zug auf die geschädigten Hufstrukturen ausüben und das Hufbein stabilisieren. In der Theorie klingt das vernünftig – doch diese Maßnahme kann in der Praxis mehr schaden als nützen. Denn durch das Hochstellen der Trachten wird der gesamte Hufmechanismus verändert.

Kann in der Praxis mehr schaden als nützen: erhöhte Trachten
Der Druck auf die Zehenspitze steigt – genau dort, wo die Verbindung zwischen Hufbein und Hufkapsel bereits geschwächt ist. Besonders bei einer Hufbeinrotation kann dies kontraproduktiv sein, da das Hufbein noch weiter nach unten kippen könnte. Die unnatürliche Hufstellung beeinflusst außerdem die gesamte Statik des Pferdes: Gelenke, Sehnen und Bänder müssen sich anpassen, was zu zusätzlichen Fehlbelastungen führen kann.
[Zum Inhaltsverzeichnis]
5.5
Blutegel-Therapie
In der Regel muss eine Blutegel-Therapie tierärztlich verordnet werden. Manchmal als obsolet abgetan, liefert sie als natürliche Maßnahme in der Behandlung von Hufrehe allerdings sehr oft gute Ergebnisse – das bestätigen nicht nur viele Pferdehalter, sondern auch wissenschaftliche Studien zur Blutegel-Therapie

Tierisch gute Hilfe bei Hufrehe: Blutegel, die bis zu eineinhalb Stunden saugen
Dabei werden Blutegel exakt an den betroffenen Stellen angesetzt, um die Durchblutung zu fördern, Entzündungen zu hemmen und den Abtransport von Stoffwechselprodukten zu unterstützen. Leidet dein Pferd unter akuter oder chronischer Hufrehe, kann ihm die Blutegel-Therapie spürbare Erleichterung bringen.
Im Speichel der Blutegel sind viele bioaktive Substanzen, die gezielt in das betroffene Gewebe gelangen. Jede davon hat von Natur aus ihre spezielle Aufgabe:
- Hirudin: Hemmt die Blutgerinnung, verbessert die Mikrozirkulation und sorgt dafür, dass entzündliche Prozesse besser abklingen können.
- Calin: Verlängert die Nachblutung – quasi wie ein sanfter, natürlicher Aderlass. Dies hilft, Stauungen abzubauen und das Gewebe zu entlasten.
- Hyaluronidase: Macht das Gewebe durchlässiger und fördert den Abbau von Ödemen, die bei Hufrehe häufig auftreten.
Wir haben hier also eine Kombination aus gerinnungshemmenden, entzündungshemmenden und durchblutungsfördernden Substanzen, mit denen du den Druck im Huf reduzieren kannst. Die Egel saugen sich fest und bleiben etwa 30 bis 90 Minuten an der Stelle, bis sie sich von selbst lösen.
„Blutegel sind nicht jedermanns und -fraus Sache. Aber:
Mit ihrem Speichel bringen sie eine natürliche Mischung aus entzündungshemmenden, durchblutungsfördernden und entlastenden Wirkstoffen direkt ins geschädigte Gewebe. Für viele Pferde mit Hufrehe bedeutet das spürbare Erleichterung – sanft, wirksam und tiefgreifend.“
„Blutegel sind nicht jedermanns und -fraus Sache. Aber:
Mit ihrem Speichel bringen sie eine natürliche Mischung aus entzündungshemmenden, durchblutungsfördernden und entlastenden Wirkstoffen direkt ins geschädigte Gewebe. Für viele Pferde mit Hufrehe bedeutet das spürbare Erleichterung – sanft, wirksam und tiefgreifend.“
Nach dem Abfallen der Egel bluten die kleinen Bissstellen noch für mehrere Stunden ganz leicht nach – ein erwünschter Effekt, da dies zur weiteren Entlastung des Gewebes beiträgt. Viele Pferde zeigen sich oft schon kurz nach der Behandlung deutlich entspannter und mobiler.
Wichtig: Die Blutegel-Therapie solltest du als Teil der Hufrehe-Behandlung verstehen. Sie ersetzt keine andere Therapie, verschafft aber Linderung und unterstützt den Heilprozess. Die Blutegel müssen außerdem unbedingt von einem Tierheilpraktiker angesetzt werden, der die nötige Erfahrung dafür mitbringt.
Ebenso solltest du die behandelten Stellen sauber halten, damit sie sich nicht infizieren. Hat dein Pferd generell Blutgerinnungsstörungen oder ein schwaches Immunsystem, solltest du dagegen von einer Blutegel-Therapie absehen.
[Zum Inhaltsverzeichnis]
5.6
Alternative Therapien gegen Hufrehe
Nicht als Ersatz aber ergänzend zu schulmedizinischen Ansätzen setzen viele Pferdehalter und Therapeuten auf alternative Methoden in der Behandlung von Hufrehe: Pflanzliche Mittel, homöopathische Ansätze und traditionelle Heilverfahren. Sie alle zielen auf eine bessere Durchblutung, Entzündungshemmung und Stoffwechselregulation ab.
Dabei ist Arnika eines der bekanntesten Mittel in der Naturheilkunde und wird aufgrund seiner entzündungshemmenden, durchblutungsfördernden und schmerzlindernden Eigenschaften häufig bei Hufrehe eingesetzt – etwa in Form von Tinkturen und Salben.
Die natürlichen Wirkstoffe der Pflanze können helfen, Schwellungen zu reduzieren und die Heilung der Huflederhaut zu unterstützen. Nichtsdestotrotz solltest du Arnika nur in kontrollierter Dosierung und nach Rücksprache mit einem Tierarzt oder Tierheilpraktiker verabreichen.
"Naturheilmittel ersetzen keine schulmedizinische Therapie
– aber sie können sie sinnvoll ergänzen. Ob Schüßlersalze, Heilpflanzen wie Mariendistel und Arnika oder durchblutungsfördernde Kräuter: Viele dieser sanften Helfer unterstützen den Organismus deines Pferdes genau dort, wo er im Kampf gegen die Hufrehe Hilfe braucht."
"Naturheilmittel ersetzen keine schulmedizinische Therapie
– aber sie können sie sinnvoll ergänzen. Ob Schüßlersalze, Heilpflanzen wie Mariendistel und Arnika oder durchblutungsfördernde Kräuter: Viele dieser sanften Helfer unterstützen den Organismus deines Pferdes genau dort, wo er im Kampf gegen die Hufrehe Hilfe braucht."
Durch Schüßlersalze soll der Zellstoffwechsel reguliert und die Regeneration der Huflederhaut gefördert werden. Bestimmte Mineralsalze sollen den Körper gezielt dabei unterstützen, Nährstoffe besser aufzunehmen und auszuscheiden. Besonders häufig werden folgende Salze empfohlen:
- Nr. 1 Calcium fluoratum – zur Stabilisierung von Bindegewebe und Huflederhaut.
- Nr. 3 Ferrum phosphoricum – als entzündungshemmendes Mittel in der Akutphase.
- Nr. 4 Kalium chloratum – zur Unterstützung des Lymphsystems und Entgiftung.
- Nr. 11 Silicea – zur Stärkung des Hufhorns und der Hufstruktur.
Auch hier solltest du dich zwecks Dosierung und Ablauf mit einem Experten abstimmen.
Die Natur hält jedoch noch viele weitere Helfer parat: Mariendistel etwa fördert die Leberfunktion und hilft damit dem Körper, Schadstoffe abzubauen. Dagegen regt Löwenzahn die Nieren- und Stoffwechselfunktionen an, während Weidenrinde als natürliche Quelle für blutverdünnende Salicylsäure gilt.
Auch Ginkgo kann die Mikrozirkulation in den feinen Blutgefäßen der Huflederhaut verbessern. Diese Pflanzen werden oft in Form von Tees, Extrakten oder speziellen Kräutermischungen verabreicht.
Ob und welche dieser Methoden sinnvoll sind, hängt individuell von Pferd zu Pferd ab. Sprich die Maßnahmen für alternative Therapien daher mit einem Experten deines Vertrauens ab.
Im Video: Mehr zur Behandlung
Darm, Leber, Körpermilieu sowie Säure-Basen-Haushalt unterstützen
Die zuvor genannten Behandlungsmethoden – Schmerzmittel, mechanische Entlastung oder alternative Therapien – bekämpfen akute Schmerzen, Entzündung und Durchblutungsstörungen. Das ist gerade im akuten Stadium einer Hufrehe absolut unerlässlich. Doch gerade, wenn du deinem Pferd langfristig helfen möchtest, reichen diese Maßnahmen allein nicht aus.
Denn die Hufrehe ist keine reine Huferkrankung, sondern in den meisten Fällen das Symptom eines tiefer liegenden Stoffwechselproblems. Wenn du dein Pferd dauerhaft stabilisieren und weitere Reheschübe vermeiden möchtest, ist immer eine ganzheitliche Unterstützung des Körpers über Fütterung und Haltung der beste Weg.
Das Ziel dieser ganzheitlichen Unterstützung ist, die entscheidenden Akteure für Stoffwechsel und Immunsystem – Darm, Leber und Körpermilieu – und den Säure-Basen-Haushalt bestmöglich zu unterstützen.
„Weil dein Pferd an Hufrehe leidet, wächst in dir der Wunsch, ihm auf allen Ebenen zu helfen
– nicht nur jetzt, sondern auch mit Blick auf die Zukunft. Du möchtest den akuten Schmerz lindern, ja. Aber vor allem suchst du nach Antworten, die euch langfristig helfen."
„Weil dein Pferd an Hufrehe leidet, wächst in dir der Wunsch, ihm auf allen Ebenen zu helfen
– nicht nur jetzt, sondern auch mit Blick auf die Zukunft. Du möchtest den akuten Schmerz lindern, ja. Aber vor allem suchst du nach Antworten, die euch langfristig helfen."
Der Darm beheimatet den größten Teil des Immunsystems. Ebenso werden hier lebenswichtige Nährstoffe aufgenommen. Sind Darm und Darmflora gestört, schadet das sowohl dem Stoffwechsel als auch dem Immunsystem. Nährstoffe werden schlechter oder gar nicht aufgenommen und Krankheitserreger wie Viren und Bakterien haben leichtes Spiel.
- Die Leber ist das zentrale Entgiftungsorgan und filtert Schadstoffe aus dem Körper. Ist sie überlastet, stauen sich Stoffwechselprodukte an – ein Risiko für Entzündungsprozesse im gesamten Organismus.
- Das Körpermilieu beschreibt die Grundstimmung des gesamten Organismus. Ist das Körpermilieu in einem schlechten Zustand, schadet dies allen wichtigen Mitarbeitern des Körpers – vom größten Organ bis zur kleinsten Zelle.
- Der Organismus ist darauf angewiesen, dass sein pH-Wert in einem bestimmten Gleichgewicht bleibt – sei es im Blut, in den Zellen oder im Verdauungstrakt. Ist der Säure-Basen-Haushalt gestört, kann der Körper Nährstoffe schlechter aufnehmen, Stoffwechselvorgänge geraten ins Stocken und Entzündungen können begünstigt werden
Vielen Pferdebesitzern ist nicht bewusst, dass diese wichtigen Bereiche des Organismus maßgeblich durch Fütterung und Haltung beeinflusst werden. Leidet das Pferd an Hufrehe, braucht es eine genau abgestimmte Fütterung, die Darm, Leber, Körpermilieu und Säure-Basen-Haushalt unterstützt und so den Stoffwechselstress reduziert: Dazu gehören faserreiches, aber zuckerarmes Heu, eine bedarfsgerechte Mineralstoffversorgung und Naturstoffe wie Propolis, Mariendistel, Ginseng oder auch Kurkuma, die sich bereits vielfach bewährt haben.
[Zum Inhaltsverzeichnis]
6.1
Das Hufrehe-Milieupflege-Set von GladiatorPLUS
Gerade weil dein Pferd an Hufrehe leidet, möchtest du alles tun, um ihm kurz- und langfristig zu helfen – und wir wissen, wie herausfordernd diese Situation für dich ist. Und weil du nicht bloß die Symptome, sondern vor allem die Ursachen der Erkrankung beseitigen willst, haben wir uns in unserer Forschungsabteilung bei GladiatorPLUS intensiv damit beschäftigt, wie wir dir und deinem Pferd dabei bestmöglich zur Seite stehen können.
Das Ergebnis ist das Hufrehe-Milieupflege-Set – eine Kombination aus GladiatorPLUS und ZELLmilieu2. Zusätzlich zu einer optimalen Ernährung und Haltung unterstützt dieses Milieupflege-Set dein Pferd dabei, Darm, Leber, Körpermilieu und den Säure-Basen-Haushalt in Balance zu halten. Denn wir wissen: Wenn der Körper ganzheitlich versorgt ist, können die Selbstheilungskräfte deines Pferdes optimal arbeiten und alle anderen Behandlungen – von Schmerztherapie bis Hufpflege – ihr volles Potenzial entfalten.
Erstens: die GladiatorPLUS Milieufütterung
Die GladiatorPLUS Milieufütterung ist ein hochwertiges Ergänzungsfuttermittel, eine All-in-one-Essenz, die mit ihren acht Premium-Naturstoffen Darm, Leber und Körpermilieu nachhaltig pflegt und so Stoffwechsel und Immunsystem optimal unterstützt. In Verbindung mit einer art- und bedarfsgerechten Haltung und Fütterung eine ideale ganzheitliche Unterstützung.

Einfach machen! GladiatorPLUS wird direkt über das Futter gegeben
GladiatorPLUS enthält wertvolle Inhaltsstoffe wie Propolis, Mariendistel, Ginseng und Kurkuma, die eine ideale Grundlage für ein stabiles inneres Milieu bieten.
Zweitens: das ZELLmilieu2-Ausleitungskonzept
Das ZELLmilieu2-Ausleitungskonzept wurde entwickelt, um den Organismus deines Pferdes gezielt zu entlasten. Es unterstützt die Stabilisierung des Säure-Basen-Haushalts und fördert die Ausleitung von Schadstoffen. Ein ausgeglichener Säure-Basen-Haushalt ist entscheidend für einen funktionierenden Stoffwechsel und ein starkes Immunsystem. Besonders Rehepferde sind häufig von Übersäuerung oder einem gestörten Gleichgewicht im Körper betroffen.

Ideale Ergänzung besonders für Rehepferde: ZELLmilieu2
Das Hufrehe-Milieupflege-Set bietet eine starke Ergänzung zu den genannten Behandlungsmethoden.
Damit du nicht allein vor der Herausforderung stehst, bekommst du mit dem Set auch Expertenwissen in
Form eines Webinars sowie einen strukturierten Plan, der dich Schritt für Schritt anleitet.
Denn unser Ziel ist es, dir nicht bloß Produkte an die Hand zu geben, sondern dich und dein Pferd mit fundiertem Wissen und einer klaren Strategie auszustatten.
Denn letztlich bist du es, der die Weichen stellt – mit jeder Entscheidung.
Ein gesundes Pferd entsteht nicht zufällig, sondern durch bewusstes Handeln.
Durch Verantwortung, die glücklich macht.

So bewahrst du dein Pferd vor der gefürchteten Krankheit
Wie du jetzt weißt, ist Hufrehe keine eigenständige Huferkrankung, sondern das Symptom eines tieferliegenden Stoffwechselproblems. Der eigentliche Ursprung liegt meist viel früher – in konkreten Stoffwechselstörungen, falscher Fütterung, einer überlasteten Entgiftung oder einer unausgeglichenen Darmflora.
Fütterung optimieren – die Basis für einen stabilen Stoffwechsel
Eines der größten Hufrehe-Risiken ist eine falsche oder nicht angepasste Fütterung. Denke daran: Fütterung ist nicht bloß die Nahrungsaufnahme – sie ist das, was den gesamten Organismus deines Pferdes formt.
Je besser du die Fütterung durchdacht und individuell auf dein Pferd abgestimmt hast, desto besser kannst du Stoffwechselerkrankungen und damit Hufrehe vorbeugen, und zwar langfristig und nachhaltig. Was du tun kannst:
7.1
Hochwertiges, faserreiches Heu füttern
Achte auf niedrige Zucker- und Fruktanwerte, außerdem keine Schimmelbelastung und keine übermäßige Staubentwicklung. Besonders bei reheanfälligen Pferden solltest du Heu mit weniger als 10 % Zucker- und Stärkegehalt füttern. Regelmäßige Heuanalysen helfen dir dabei, die Qualität deines Heus einzuschätzen und gegebenenfalls durch Einweichen oder Anpassen der Futterration gegenzusteuern.
Vermeide zu lange Fresspausen
Pferde sind geborene Dauerfresser – ihr Verdauungssystem ist darauf ausgelegt, über den Tag verteilt ständig kleine Mengen rohfaserreicher Nahrung aufzunehmen. Längere Fresspausen von mehr als 4–6 Stunden können den Stoffwechsel belasten, Insulinspitzen auslösen und das Risiko für Stoffwechselstress erhöhen – einem der Hauptauslöser für Hufrehe.

Pferde sind Dauerfresser – sonst bekommen sie Stoffwechselstress
Deshalb:
- Stelle sicher, dass dein Pferd rund um die Uhr Zugang zu Raufutter hat.
- Falls eine freie Heufütterung nicht möglich ist (z. B. bei EMS oder Übergewicht), verwende Heunetze mit kleiner Maschenweite (3–4 cm), um die Fresszeit zu verlängern, ohne dass dein Pferd zu viel auf einmal frisst.
- Strukturreiches Futter wie unmelassierte Rübenschnitzel oder ein kleiner Anteil Stroh kann helfen, die Kautätigkeit zu verlängern und den Insulinspiegel stabil zu halten.
- Auch nachts sollte dein Pferd nicht über viele Stunden ohne Futter stehen. Falls es aus Managementgründen längere Pausen gibt, hänge spätestens abends ein engmaschiges Heunetz auf.
„Für reheanfällige Pferde ist die richtige Fütterung das A und O:
Der Zucker- und Fruktangehalt im Heu sollte unter 10 % liegen. Genauso wichtig wie das ‚Was‘ ist das ‚Wann‘ – denn zu lange Fresspausen können den Stoffwechsel aus dem Takt bringen."
„Für reheanfällige Pferde ist die richtige Fütterung das A und O:
Der Zucker- und Fruktangehalt im Heu sollte unter 10 % liegen. Genauso wichtig wie das ‚Was‘ ist das ‚Wann‘ – denn zu lange Fresspausen können den Stoffwechsel aus dem Takt bringen."
Dein Ziel ist es, den Stoffwechsel stabil zu halten und Insulinspitzen zu vermeiden – denn diese können langfristig zur Entstehung von Hufrehe beitragen.
[Zum Inhaltsverzeichnis]
7.2
Weidegang kontrollieren
Fruktangehalt beachten
Gerade im Frühjahr und Herbst kann der Fruktangehalt im Gras stark schwanken. Wie du nun weißt, können Fruktane den Darm belasten und eine Kettenreaktion im Stoffwechsel auslösen. Was solltest du also tun?
- Langsames Anweiden statt plötzlicher Wechsel auf saftige Wiesen.
- Begrenzte Weidezeiten, besonders morgens und abends, wenn die Fruktankonzentration steigt.
- Eine Fressbremse kann die Grasaufnahme reduzieren und so das Risiko weiter senken.
7.3
Kraftfutter überdenken
Weniger ist oft mehr! Viele getreide- und zuckerreiche Futtermittel sind überflüssig und können den Stoffwechsel unnötig belasten. Bei Pferden mit Hufrehe oder einem hohen Stoffwechselrisiko solltest du besser gar keine oder nur minimale Mengen an stärkehaltigem Kraftfutter füttern. Stattdessen:

Beim Kraftfutter gilt: Gut überlegt füttern!
- Unmelassierte Rübenschnitzel – sie liefern Energie, ohne den Blutzuckerspiegel stark zu beeinflussen.
- Ölsaaten (z. B. Leinsamen) und strukturreiche Fasern – sie sind wertvolle Energiequellen, ohne zu viel Stärke und Zucker zuzuführen.
Mineralfutter ohne Getreide und Melasse – damit stellst du sicher, dass dein Pferd viele wichtige Nährstoffe erhält, ohne den Stoffwechsel zu belasten.
[Zum Inhaltsverzeichnis]
7.4
Gezielte Mineralstoffversorgung
Fehlen dem Körper deines Pferdes bestimmte Spurenelemente, kann das den Stoffwechsel zusätzlich aus dem Gleichgewicht bringen. Vor allem Zink, Magnesium und Selen sind besonders wichtig für die Hufgesundheit, die Regeneration der Huflederhaut und den gesamten Zellstoffwechsel. Mit einem gezielt abgestimmten Mineralfutter schließt du Versorgungslücken und machst dein Pferd widerstandsfähiger.
7.5
Als Teil einer gesunden Ernährung: Milieufütterung
Eine optimale Fütterung besteht unter anderem aus hochwertigem Heu, angepasstem Weidegang und einer gezielten Mineralstoffversorgung. Ein Teil dessen kann auch die Milieufütterung sein, mit der du das Körpermilieu deines Pferdes aktiv unterstützen kannst.
Sie hilft, die natürlichen Regulationsmechanismen des Körpers zu stärken, den Stoffwechsel zu entlasten und die Widerstandskraft deines Pferdes langfristig zu fördern. Ein ausbalanciertes Körpermilieu sorgt dafür, dass dein Pferd Nährstoffe besser verwerten, Stoffwechselprozesse effizienter regulieren und Belastungen besser ausgleichen kann.
Gerade reheanfällige Pferde profitieren davon, denn du nutzt die Kraft ausgewählter Naturstoffe dazu, um bei deinem Pferd das körpereigene Milieu und seine wichtigen Akteure – Darm, Leber, Zelle – gleichzeitig und gezielt mit wertvollen Nährstoffen zu unterstützen. Das trägt dazu bei Entzündungsprozesse zu regulieren, die Darmgesundheit zu stärken und das Immunsystem zu widerstandsfähig zu halten.

Wir empfehlen dir, die Milieufütterung mit GladiatorPLUS in die tägliche Fütterung zu integrieren, weil sie gleich acht Premium-Naturstoffe vereint, die den Schlüssel zu einem ausgeglichenen Körpermilieu liefern:
- Propolis: Der Schutzstoff der Bienen – ein Kraftpaket für das Immunsystem.
- Mariendistel: Pflegt die Leberfunktion und stärkt die körpereigenen Entgiftungsmechanismen.
- Kieselsäure: Der Baustoff für innen und außen – erhält Haut, Haare und Bindegewebe.
- Ginseng: Die uralte Energiequelle – für mehr Vitalität und Lebensfreude.
- Heidelbeere: Das antioxidative Kraftpaket, das freie Radikale in Schach hält.
- Kurkuma: Enthält Curcumin, als entzündungshemmendes und verdauungsförderndes Multitalent bekannt.
- Artischocke: Unterstützt Verdauung und Leber.
- Rote Bete: Reich an Mineralstoffen und damit wertvoll für Verdauung, Zellkraft und Immunsystem.
In der Heilkunde werden diese Naturstoffe seit Jahrhunderten geschätzt – von der indischen über die chinesische bis zur europäischen Tradition. Sie ergänzen sichin dieser klug ausgewählten Kombination nicht bloß, sondern verstärken sich gegenseitig. Aus 1+1 wird auf diese Weise nicht nur 2, sondern 100.
Vor allem unterstützen sie gleichzeitig mehrere positive Kreisläufe im Körper deines Pferdes und sorgen ergänzend zu einer ausgewogenen Ernährung und einer ausgeglichenen Lebensweise dafür, das innere Körpermilieu aufrechtzuerhalten. Dein Tier schafft es, sich optimal selbst zu versorgen, zu regenerieren und Energie freizusetzen, wenn es sie braucht.
GladiatorPLUS ist deine ganzheitliche Lösung. Und zwar mit nur einem konzentrierten Schluck. Statt also etliche verschiedene Ergänzungsmittel gleichzeitig füttern zu müssen, hast du eine All-in-one-Essenz zur Hand.
Einer der größten Vorteile der Milieufütterung: Du kommst auf Dauer weg davon, einzelne Symptome und Defizite zu bekämpfen. Stattdessen hilfst du deinem Pferd dabei, seine eigenen Regulationssysteme zu stärken.
[Zum Inhaltsverzeichnis]
7.6
Optimiere die Haltung und Bewegung deines Pferdes
Pferde sind keine Stehtiere! Sie sind von Natur aus dafür geschaffen, sich über den Tag verteilt kontinuierlich zu bewegen. Fehlt diese Bewegung oder steht dein Pferd in einer ungeeigneten Umgebung, steigt das Risiko für Stoffwechselstörungen und damit auch für Hufrehe. Dagegen fördert die richtige Haltung in Kombination mit ausreichend Bewegung die Hufgesundheit, und damit die Durchblutung der Huflederhaut.
7.7
Schaffe optimale Bodenverhältnisse
Dein Pferd kommt nicht dauerhaft auf harten, steinigen oder permanent matschigen Böden zurecht. Untergründe wie diese können langfristig zu Fehlbelastungen oder Entzündungen führen. Auch das andere Extrem – ständiges Stehen auf zu weichem Untergrund – kann für dein Pferd problematisch sein, weil der Hufmechanismus nicht ausreichend stimuliert wird.

Bei Rehepferden wichtig: dicke, weiche Einstreu
Idealerweise lässt du dein Pferd auf wechselnde, aber trittsicheren Böden. Das kann beispielsweise ein Offenstall mit unterschiedlich beschaffenen Böden sein – Sand, Schotter, fester Untergrund. Langes Stehen auf Beton oder in Boxenhaltung ohne Auslauf beeinträchtigen die Durchblutung der Huflederhaut. Falls du dein Pferd in einer Box hältst, sorge für eine dicke, weiche Einstreu. Das reduziert den Druck auf die Hufe und macht das Stehen angenehmer.
7.8
Fördere die Bewegung
Idealerweise lässt du dein Pferd auf wechselnde, aber trittsicheren Böden. Das kann beispielsweise ein Offenstall mit unterschiedlich beschaffenen Böden sein – Sand, Schotter, fester Untergrund. Langes Stehen auf Beton oder in Boxenhaltung ohne Auslauf beeinträchtigen die Durchblutung der Huflederhaut. Falls du dein Pferd in einer Box hältst, sorge für eine dicke, weiche Einstreu. Das reduziert den Druck auf die Hufe und macht das Stehen angenehmer.
Es ist wie bei uns Menschen: Pferde, die sich zu wenig bewegen, entwickeln Probleme mit Muskeln und Gelenken – und mit dem Stoffwechsel. Dagegen unterstützt regelmäßige Bewegung die Durchblutung der Hufe, senkt das Risiko für Übergewicht und hält den Zuckerstoffwechsel stabil.

Schritt für Schritt Richtung Gesundheit – mit Bewegung
- Freie Bewegung auf der Koppel oder im Offenstall ist optimal, weil dein Pferd so selbst entscheiden kann, wie viel es sich bewegt.
- Falls dein Pferd in Boxenhaltung lebt, solltest du es täglich bewegen – sei es durch gezieltes Führen, lockeres Training oder Spaziergänge.
- Reheanfällige oder stoffwechselempfindliche Pferde sollten möglichst täglich moderate Bewegung bekommen, da dies den Insulinspiegel reguliert und den Lymphfluss unterstützt.
Während in der akuten Phase der Hufrehe strikte Ruhe nötig ist, solltest du, sobald sich dein Pferd erholt hat, langsam wieder Bewegung in den Alltag integrieren. Das bringt die Durchblutung in Schwung und stabilisiert den Stoffwechsel.
7.9
Reduziere Stress
Ständige innere Unruhe und dauerhafter Stress können den Hormonhaushalt negativ beeinflussen, Insulinresistenz begünstigen und Entzündungen im Körper fördern. Besonders sensible Pferde oder solche, die in einer unstimmigen Herdenstruktur leben, haben dadurch ein höheres Erkrankungsrisiko. Wie kannst du Stress minimieren?

Stress lass nach! Ein sicheres, beständiges Umfeld ist wichtig
- Sorge für eine stabile, harmonische Herdenstruktur. Häufige Gruppenwechsel oder soziale Spannungen sind wahre Stressquellen.
- Ein ruhiges Umfeld im Stall und beim Training hilft deinem Pferd, entspannt zu bleiben und den Cortisolspiegel nicht unnötig in die Höhe schießen zu lassen.
Pferde lieben Routinen. Regelmäßige, vorhersehbare Abläufe bei der Fütterung, im Training und im gemeinsamen Alltag geben deinem Pferd Sicherheit.
[Zum Inhaltsverzeichnis]
7.10
Behalte die Hufgesundheit im Blick
Mit gesunden Hufen kann sich dein Pferd frei und harmonisch bewegen und sein Körpergewicht optimal darauf verteilen. Außerdem werden seine Sehnen, Bänder sowie Gelenke weniger belastet. Und das fördert die Durchblutung der Huflederhaut und mindert das Hufrehe-Risiko. Viele gute Gründe also, weshalb du die Hufgesundheit im Blick behalten und dafür sorgen solltest, dass dein Pferd die bestmögliche Hufpflege bekommt.
Regelmäßige Hufbearbeitung – essenziell für Balance und Stabilität
Weil Pferdehufe kontinuierlich wachsen, müssen sie regelmäßig korrigiert werden. Lasse alle vier bis sechs Wochen eine professionelle Hufbearbeitung durch einen erfahrenen Hufschmied oder Hufpfleger durchführen, damit die Hufstellung natürlich und gesund bleibt. Denke auch daran, rechtzeitig Termine zu vereinbaren, da die Wartezeiten mitunter länger sind als die Pflegeintervalle.
"Gesunde Hufe tragen weit mehr als nur das Gewicht deines Pferdes.
Nur, wenn der Huf regelmäßig bearbeitet und gepflegt wird, lassen sich Fehlbelastungen vermeiden und das Risiko für Hufrehe deutlich senken.“
"Gesunde Hufe tragen weit mehr als nur das Gewicht deines Pferdes.
Nur, wenn der Huf regelmäßig bearbeitet und gepflegt wird, lassen sich Fehlbelastungen vermeiden und das Risiko für Hufrehe deutlich senken.“
- Beobachte die Hufe deines Pferdes auf ungleichmäßige Abnutzung, Risse oder eine veränderte Zehenstellung.
- Achte darauf, dass die Hufe weder zu lang noch zu kurz werden.
Jedes Pferd hat eine individuelle Hufform. Manche Pferde haben eine natürlich steile Hufform, andere neigen zu untergeschobenen Trachten oder einer zu langen Zehe. In vielen Fällen kann eine gezielte Anpassung der Hufbearbeitung dazu beitragen, den Hufmechanismus deines Pferdes zu unterstützen und es in seiner Bewegung zu entlasten.
Im Video: Tipps von Experten
Kontrolliere regelmäßig Gewicht und Stoffwechsel
Wie bei vielen anderen Dingen schleichen sich die Veränderungen über Monate hinweg ein – hier ein paar Kilo, dort ein paar weichere Fettpolster. Oder aber kleine Schwankungen im Stoffwechsel, die man mit bloßem Auge nicht immer sofort bemerkt. Doch je früher du Auffälligkeiten erkennst, desto besser kannst du gegensteuern.
[Zum Inhaltsverzeichnis]
7.11
Gewichtskontrolle in regelmäßigen Abständen
Übergewicht ist ein Hufrehe-Risikofaktor – gerade dann, wenn dein Pferd von Natur aus leichtfuttrig ist oder zu Stoffwechselproblemen neigt. Überprüfe das Gewicht deines Pferdes deshalb regelmäßig. Das kannst du naheliegenderweise mittels einer Waage tun. Schieße aber ab und zu mal ein Foto von deinem Tier, damit du auch optische Veränderungen besser nachvollziehen kannst.

Ein gewichtiger Grund für Rehe: das Gewicht
7.12
Blutwerte regelmäßig checken
Das Gewicht ist „nur“ eine Zahl. Und so kann es gerade bei Pferden mit Stoffwechselerkrankungen wie EMS (Equines Metabolisches Syndrom) oder Cushing sinnvoll sein, auch die Blutwerte checken zu lassen. Sie geben dir einen Einblick in die Stoffwechsellage deines Pferdes und helfen dir, frühzeitig kritische Entwicklungen zu erkennen, bevor es zu einem Reheschub kommt.

Regelmäßige Blutchecks decken auf, wie es dem Stoffwechsel deines Pferdes geht
So kann hinter einem dauerhaft erhöhten Insulinspiegel eine Insulinresistenz stecken, während ständig hohe Glukosewerte darauf hindeuten, dass der Zuckerstoffwechsel deines Pferdes gestört ist – häufig bei EMS- oder Cushing-Patienten zu beobachten. Dagegen sind schlechte Leber- und Nierenwerte ein Zeichen dafür, dass sie als Entgiftungsorgane stark gefordert sind, was wiederum den gesamten Stoffwechsel belastet.
Ebenfalls wichtig in dem Zusammenhang: der Säure-Basen-Haushalt. Ist dieser nicht im Gleichgewicht, kann sich das ebenfalls in den Blutwerten widerspiegeln, etwa durch veränderte Elektrolytwerte, einem erhöhten Laktatwert oder niedrigem ph-Wert.
Eine anhaltende Übersäuerung erschwert es dem Körper deines Pferdes, Nährstoffe optimal aufzunehmen und zu verwerten, die Entgiftung zu regulieren und entzündliche Prozesse zu kontrollieren. Gerade bei Stoffwechselerkrankungen, die mit Hufrehe in Verbindung stehen, spielt das Säure-Basen-Gleichgewicht deshalb eine wichtige Rolle.

Blutwerte regelmäßig checken
Das Gewicht ist „nur“ eine Zahl. Und so kann es gerade bei Pferden mit Stoffwechselerkrankungen wie EMS (Equines Metabolisches Syndrom) oder Cushing sinnvoll sein, auch die Blutwerte checken zu lassen. Sie geben dir einen Einblick in die Stoffwechsellage deines Pferdes und helfen dir, frühzeitig kritische Entwicklungen zu erkennen, bevor es zu einem Reheschub kommt.
Wie du heute erfahren hast, ist Hufrehe kein unausweichliches Schicksal, sondern oft das Ergebnis einer langen Kette von Ungleichgewichten im Stoffwechsel. Sie zeigt sich am Huf, doch ihr Ursprung liegt tiefer – in der Fütterung, in der Haltung, in der Belastung des Körpers und in der Stabilität des Körpermilieus.
Doch die gute Nachricht ist: Du hast es in der Hand, Hufrehe zu vermeiden, wenn du rechtzeitig die richtigen Maßnahmen ergreifst. Dazu musst du ganzheitlich denken und langfristig sinnvolle Veränderungen umsetzen, anstatt nur auf akute Symptome zu reagieren. Merke: Es geht immer darum, dein Pferd in einem Zustand zu halten, in dem es widerstandsfähig bleibt und gar nicht erst erkrankt.
Du hast nun gesehen, wie eng all die verschiedenen Faktoren miteinander verknüpft sind. Die richtige Ernährung schützt vor Stoffwechselstress, viel Bewegung hält die Durchblutung in Schwung, eine stabile Darmflora stärkt das Immunsystem, und ein ausgeglichener Säure-Basen-Haushalt trägt dazu bei, Entzündungen zu vermeiden. Kein einzelner Punkt für sich allein reicht aus – doch im Zusammenspiel bilden sie ein starkes Fundament für die Gesundheit deines Pferdes.
Kommt es dennoch zu einem akuten Reheschub, zählt jede Minute. Erste Hilfe bedeutet in diesem Fall, die Entzündung sofort einzudämmen: Kühlung mit eiskaltem Wasser, eine weiche Unterbringung und absolute Ruhe sind jetzt das A und O. Auch sollte sich jetzt relativ schnell ein Tierarzt oder Tierheilpraktiker der Sache annehmen und mit der Behandlung loslegen.
Das reicht von entzündungshemmenden sowie schmerzlindernden Medikamenten und mechanischer Entlastung der Hufe durch Hufpolster bis hin zu alternativen Behandlungsmethoden. Gleichzeitig muss die Fütterung sofort angepasst werden – kein Kraftfutter, stattdessen hochwertiges Heu mit niedrigem Zuckergehalt und eine gezielte Mineralstoffversorgung.

Futter gut, alles gut? Auf jeden Fall besser. Bei Rehe ist Fütterung ein entscheidender Faktor
Damit es gar nicht aber erst so weit kommt, ist die Vorbeugung euer bester Freund. Den Stoffwechsel deines Pferdes entlastest du mit faserreichem, aber zuckerarmem Heu, kontrolliertem Weidegang und dem Verzicht auf übermäßiges Kraftfutter. Außerdem: tägliche Bewegung, eine regelmäßige Hufbearbeitung und eine gezielte Milieupflege. Mit letzterer sorgst du für eine gesunde Darmflora, entlastest die Leber und stabilisierst den Säure-Basen-Haushalt. All das unterstützt die natürlichen Regulationsmechanismen. Dazu noch eine harmonische Herdenstruktur und ein stressfreies Umfeld – und dein Pferd ist optimal gewappnet.
Apropos stressfrei: Bedenke auch, dass Angst ein schlechter Ratgeber ist. Denn egal ob gesund oder inmitten eines Hufrehe-Schubs – das Letzte, was dein Pferd gebrauchen kann, ist eine von Sorge, Stress oder gar Panik erfüllte Umgebung. Stattdessen braucht das Tier jemanden, der besonnen bleibt, Verantwortung übernimmt und sich Wissen aneignet, um es bestmöglich zu schützen.
Auch, wenn du nicht einfach von heute auf morgen alles an Wissen aufnehmen kannst und man als Pferdehalter nie auslernt, so möchten wir dich dennoch dazu ermutigen: Werde der Experte für dein Tier! Es gibt viele großartige Tierärzte und Therapeuten dort draußen, doch am Ende bist du der Mensch, der dein Pferd regelmäßig sieht, seine Bedürfnisse kennt und der bemerkt, wenn sich etwas verändert.
Je mehr du selbst weißt und je mehr du verstehst, desto sicherer wirst du Entscheidungen treffen – und dich weniger von Unsicherheit oder widersprüchlichen Aussagen beeinflussen lassen. Denn echte Verantwortung bedeutet nicht nur, dein Pferd zu begleiten, sondern ihm die besten Voraussetzungen für ein gesundes, widerstandsfähiges Leben zu bieten. Und bewusste Entscheidungen für dein Pferd sind die beste Vorsorge, die du treffen kannst. Eben Verantwortung, die glücklich macht!
Die Wiesen blühen, die Sonne scheint, der Sommer steht vor der Tür – herrlich! Frühling – eigentlich die schönste Zeit im Jahr für dich und dein Pferd. Doch dein Pferd hustet dir was. Und du fragst dich: Warum ausgerechnet jetzt? Oft steckt ein allergischer Husten dahinter. Und damit ist dein Pferd längst nicht allein. Immer mehr Pferde reagieren in der warmen Jahreszeit mit allergischen Atemwegsproblemen – der „Schönwetter-Husten“ ist seit Jahren auf dem Vormarsch.
Du willst wissen, wie es deinem Hund wirklich geht? Eine Kotanalyse gibt dir Antworten – ehrlich, direkt und oft überraschend, denn sie zeigt, wie es im Inneren deines Hundes wirklich aussieht – was du aus einer Analyse lernen kannst, wie du sie richtig interpretierst und welche typischen Fehler du besser vermeidest, erfährst du hier.
Natürlich weißt
Wenn dein Hund sich kratzt, niest oder hustet, kann das mit seiner Immunbalance zu tun haben – denn häufig ist ein aus dem Gleichgewicht geratenes Körpermilieu die wahre Ursache hinter solchen Symptomen, während herkömmliche Mittel oft nur oberflächlich beruhigen, statt den Organismus ganzheitlich zu unterstützen und zu stärken.
Wusstest du, dass etwa jeder fünfte Hund an einer Allergie leidet?
Tendenz steigend. Vielleicht ist dir bei deinem auch schon etwas aufgefallen – Juckreiz, Pfotenlecken und Augenentzündungen bis hin zu Durchfall. Manchmal bilden sich schneller